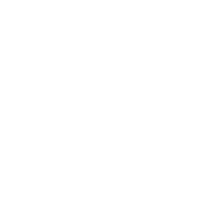Gregory Crewdson: Momente alltäglicher Trostlosigkeit.
In: Zeitschrift KUNST 5 –10, Heft 28/2012 (Friedrich Verlag), S. 44 ff

Abbildung unter:
https://artblart.files.wordpress.com/2012/10/crewd-2003-2005-untitled-maple-street-web.jpg
Mit seiner eigensinnigen Arbeitsweise schafft der 1962 in Brooklyn, New York, geborene Fotokünstler Gregory Crewdson auf den ersten Blick irritierend wirkende Bildwelten. Unweigerlich versuchen die Betrachter angesichts der beklemmend wirkenden Szenerien sinnhafte Zusammenhänge zu konstruieren, um dem Geheimnisvollen auf die Spur zu kommen. Wird eine Geschichte erzählt? In welcher Verbindung stehen die agierenden Personen zueinander? Oder worauf verweisen die eingesetzten Requisiten? Denn was hier festgehalten wurde, geht in seiner trügerischen Lückenhaftigkeit spürbar über das hinaus, was eine fotografische Wiedergabe normalerweise leistet.
Unser sondierender Blick fällt auf eine nächtliche und nur hier und dort gespenstisch beleuchtete Szenerie, in deren Zentrum eine hagere, von rechts spärlich beleuchtete junge Frau steht. Barfüßig. Ihr Blick ist gesenkt, sie wirkt statuenhaft abwesend und trägt lediglich ein weißes Unterkleid. Ein anderes Kleidungsstück, wie eilig zusammengerafft, hält sie schützend vor sich. Vermutlich hat sie soeben das von der Rückseite gezeigte, mit zwei männlichen Personen besetzte Taxi verlassen. Eine der hinteren Autotüren blieb weit geöffnet, – was zusätzlich den Eindruck des Augenblicks bestärkt. Was ist passiert? Warum ist sie ausgestiegen? Zögert sie heimzukehren? Oder ist wegen ihrer dürftigen Bekleidung Sex im Spiel, – geht es gar um ein Liebesdrama? Oder ist alles total anders? Mit Gewissheit dürfen wir davon ausgehen, dass jenseits unserer objektiven Wahrnehmung eine verborgene Realität existiert, deren Untergründe man nur erahnen kann.
Die unheimlich erscheinende Fotoarbeit stammt aus der vielteiligen Serie »Beneath the Roses«, die Crewdson von 2003 bis 2005 fertigte (Abb. 1). Er beziffert seine Fotos lediglich, ihre Titel sind vieldeutig. Wie andere Beispiele aus seinen Serien erscheint auch diese Einzelaufnahme wie eine suggestive Kulisse aus einem erregenden Krimi zwischen Hitchcock oder Spielberg. Dramatisch beleuchtet, mysteriös, trostlos. Gleich mehrere, nur scheinbar nebensächliche Details, wie der bejahrte Gran Fury von Chrysler aus den 60er Jahren, abblätternde Wandfarbe, die merkwürdig erleuchtete Veranda des Holzhauses oder die Wasserpfützen und Risse im Straßenbelag verstärken sich zu Indizien eines kärglichen amerikanischen Lebensalltags. Dazu in einer verlotterten Gegend. Es gab schon bessere Zeiten, – insofern weist vieles auf einen scharfsichtigen Realismus hin, der nüchtern die Antithese eines stereotypen American Way of Life mit seinen bigotten Sonnenseiten illustriert.
In der Rezeption Gregory Crewdsons aufwändig inszenierten Fotografien wird immer wieder – manchmal allzu hochtönend – auf ihren geradezu übersteigerten Bezug zum alten Hollywoodfilm, dessen Inszenierungskünste, kinematischen Stilmittel, seine oft überspannten Kulissen oder auch seine finanziellen Erfolge hingewiesen. Und in der Tat ähneln die mit großem organisatorischen Aufwand perfekt arrangierten Fotos auffallend jenen gezielt geschossener »Production Stills«, die, ein eigenes Genre darstellend, zur Dokumentation oder Reklame des jeweiligen Streifens benötigt werden. „Die Vergleiche zum Kino erklären sich auch aus der Komposition und Inszenierung des Bildinhalts – aus der speziellen Art, die Aufnahmen zu realisieren. Sie verschleiern ihre Inszenierung nicht (...), die Bilder werden wie Studiosets aufgebaut, die meisten von ihnen (entstanden) in oder unweit der verfallenden Industriestadt North Adams oder in und um Pittsfield, Massachusetts“, notiert der amerikanische Romancier Russell Banks. (Ders., S. 6)
Kein Zweifel, denn was sich in unserer bedrückenden Fotoarbeit zwischen Fiktion und Wirklichkeit im emotional aufgeladenen Dunkel der Nacht abspielt, knüpft nahtlos an die melodramatischen Geschichten gefeierter Hollywoodfilme an, deren psychologische Effekte dank heimtückischer Verbrechen, verwegener Ehedramen oder sonstiger Torturen dennoch meist überraschend in ein versöhnendes Happy End einmünden. Jedoch liegt genauso augenfällig die ikonografische Verbindung zu den absurden Gestalten des Surrealismus oder zu den amerikanischen Traditionslinien inszenierter Fotografien auf der Hand, denn einige der ausgefeilten Szenerien von Beneath the Roses erinnern unverkennbar an Fortführungen der Bilder von William Eggleston, Joel Meyerowitz oder Jeff Wall. Auch rufen einige der Einzelszenen sentimentale Erinnerungen an die Malerei Edward Hoppers in uns wach.
In Crewdsons Arrangements ist mithin jedes kleinste Detail semantisch aufgeladen, nichts, aber auch überhaupt nichts ist dem Zufall überlassen. Dazu gehört, dass er zu jedem Foto eine Unzahl akribischer Planungsskizzen fertigt. Nicht zuletzt deshalb bezeichnet ihn Russel Banks als einen „Kartografen des spezifisch amerikanischen Alltäglichen“, der die Widersprüche zwischen überbordenden Warenangeboten mit ihrem sorglos-zerstörerischem Konsum und gleichzeitig die depressive Leere hinter den glitzernden Fassaden abzirkelt. Dies bedrückend Alltägliche lässt sich – geradezu beliebig – an vielen kollektiven amerikanischen Verhaltensmustern aufzeigen, etwa an Las Vegas´ Plastik-Kulissen ebenso wie am Fast food, am Erfolg pseudoreligöser Heilsversprechen oder einem ungezügelten Mediengebrauch. Damit zeigen uns die Bilder von Beneath the Roses zielsicher die psychologischen Muster amerikanischer Normalität: Momentaufnahmen unerzählter Tragödien inmitten einer Wirklichkeit, in der Idylle und Horror beängstigend dicht beieinander liegen.
Quellen:
– Banks, Russell in: Gregory Crewdson. Beneath the Roses. Werke 2003–2007.
Ostfildern 2008
– Weiss, Matthias: Was ist ›inszenierte Fotografie‹? Eine Begriffsbestimmung.
In: Blunck, Lars (Hg.): Die fotografische Wirklichkeit. Inszenierung – Fiktion – Narration.
Bielefeld 2010, S. 37 ff.
© Werner Stehr
Gregory Crewdson: Momente alltäglicher Trostlosigkeit