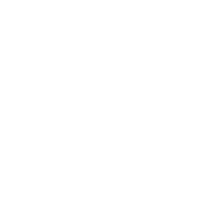Eiertanz, Pieter Breughel d. J., um 1620 in Privatbesitz, Belgien
aus: Breughel - Brueghel, Essen 1997, S. 409, Abb. 139
Vortrag anlässlich des Symposions „Das gymnasiale Lehramt Kunst. Situation und Perspektiven
der 1. und 2. Phase“ im Januar 2003 in der Akademie der Künste in München (siehe Website der AdK).
Unter gleichem Titel [gekürzt] erschienen in: BDK Mitteilungen, Heft 2/2003, S. 2-5

Inhalt:
1. Ende des wohlfahrtsstaatlichen Wachstumsmodells
-
2.Eingrenzung auf das verminte Gelände von Lehrerausbildung und die beruflichen Tätigkeiten von Kunsterziehern
-
3.Qualitative Weiterentwicklung
4. Professionalität und berufliche Anforderungen an Kunstpädagogen
5. Qualifizierung von Studierenden und der Stellenwert schulpraktischer Studien
6. Zweite Phase – Integration in den Schulbetrieb
7. Aufgaben der Zentren für Lehrerbildung
8. Der Eiertanz als Metapher
1. Ende des wohlfahrtsstaatlichen Wachstumsmodells
Jede redliche Diskussion um die Frage zukünftiger Schulentwicklung, und darin aufgehend jene ihrer Lehrerbildung, sollte neben dem drängenden Reformbedarf die bildungs- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen illusionslos im Auge behalten. Besonders durch die aufgeregten Diskussionen nach den Ergebnissen von PISA hat sich der politische Wille nach Veränderung unseres gesamten Bildungswesens spürbar erhöht, Chancen für Veränderungen sind vermutlich günstig wie nie zuvor. Hans-Günter Rolff sprach unlängst in der Frankfurter Rundschau (FR 2002) sogar von der „Stunde der Schulentwicklung“, weil seit langem offenkundig die bekannten Mängel des Systems durch die internationale Vergleichsstudie nun zusätzlich empirisch bestätigt seien.
Aus seiner ambivalenten Erfolgsgeschichte heraus erklärt, ist der traditionelle Selbstlauf des Bildungssektors als permanentes Modernisierungskonzept oder „klassisches Wachstumsparadigma“ vor allem unter quantitativ-expansiven Erwägungen längst an seine Grenzen gelangt. Die häufig beklagten Nebeneffekte antiquierter Großorganisationen sind bekannt: bürokratische Schwerfälligkeit, Neigung zur Überregulierung, berechtigte Zweifel an der Leistungsfähigkeit, aufgeblähte Verwaltungen, ein verkrustetes Berufsbeamtentum etc. Das alles entwickelte sich eher naturwüchsig, doch zugleich auch als Folge des wohlfahrtsstaatlichen Integrationsversuchs, um mit administrativ gesteuerten Maßnahmen vor allem gesellschaftliche Mittelstandsgruppen und ihre Interessen stets aufs neue zu befriedigen.
Durch die inzwischen verbreitete Skepsis gegenüber herrschender Systemsteuerung (Umwelt, Verkehr, Sozialpolitik, Landwirtschaft etc.) wird inzwischen auch in unserem Metier aufmerksam registriert, dass sich „im Kontext alternativer, transklassischer Modernitätsvorstellungen, in denen Staat, Bürokratie und Wissenschaft gerade nicht mehr im Mittelpunkt stehen, [...] neue Vorstellungen von Lehrerausbildung entwickelt haben, die den Anspruch erheben, heute die eigentliche, zeitgemäße Form von Modernität in diesem Bereich darzustellen.“ (Terhart 1999, S.6) Seit geraumer Zeit schon schlagen diverse Gutachten daher einen energischen Kurswechsel vor; die meisten alternativen Ideen sind einer Verzahnung bzw. Kooperation bisher separierter Bereiche der Lehrerbildung verpflichtet und nehmen die populären Defizitanalysen (Struck 1997, Terhart 1992, Dalin 1997) ebenso in sich auf wie positive Erfahrungen des Auslands (Schweiz, Niederlande, Kanada). Besonders zu nennen sind die KMK, die Hochschulrektorenkonferenz, die Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften sowie vor allem mehrere Arbeitsgruppen einzelner Bundesländer (Hessen, Hamburg, Niedersachsen, NRW u.a.), die mit zielführenden Vorschlägen die Diskussion beschleunigten. Aus diesen Berichten wiederum ging eine regelrechte Flut weiterer Abhandlungen zur zukünftigen Konzeption oder Organisation der Lehrerbildung hervor, die das vorhandene Gesamtsystem in seinen vielen Fassetten vom Kindergarten bis zur Universität auf den Prüfstand stellen möchten und die, je nach sozialpolitischer Ausrichtung, höchst verschiedenartige Lösungsmodelle unterbreiten. Manche der Alternativkonzepte sind freilich nichts anderes als verkappte Sparmodelle im Sinne einer „lean education“ und vernebeln geschickt den wahren Hintergrund finanzpolitischer Pressionen. Das alles bildet gleichsam den kühlen Schatten von TIMSS und PISA, der allerdings zugleich die „Quittung für eine inkonsequente Bildungsreform“ (FR v. 19.07.2002, S.6) darstellt, denn seit vielen Jahren kam es, allen alarmierenden Diagnosen zum Trotz, zu keinen überezeugenden Alternativkonzepten. Beispielsweise vervielfachten sich seit Anfang der neunziger Jahre die Studierendenzahlen in den Lehramtsstudiengängen, ohne dass es irgendeine steuernde Intervention auslöste - die zerstückelte, weitgehend der Regie der Länder überlassene Lehrerbildung wurde nur höchst selten angetastet.
Aus vordergründigen Motiven der Wahrung von Besitzständen wäre es sicherlich ein falscher Weg, der möglichen Veränderung des Status quo sogleich mit Abwehr zu begegnen, denn das System muss beweglicher, effektiver und transparenter werden – ob einzelne Interessengruppen es akzeptiert oder nicht. Die Resultate von PISA zeigen unter anderem recht deutlich, dass die mittlerweile ungeduldige Kritik nicht kausal durch die öffentliche Finanzkrise und allen daraus folgenden Einsparungszwängen oder - noch eindimensionaler - durch die Rückwirkungen einer globalen New Economy zu erklären sind. Inzwischen ist es opportun angesichts ehemals heiliger Kühe die unpopuläre Frage nach Kosten und Nutzen staatlicher Bildungs- und Ausbildungsinvestitionen zu stellen und beispielsweise die international vergleichsweise üppigen Gehälter und Pensionsbezüge deutscher Unterrichtsbeamter zu thematisieren. Längst steht ihr Status mit all seinen Vorzügen und Nachteilen zur Disposition. Ebenso zeugt es nicht von Weltfremdheit zu registrieren, dass jede spezifische Leistungserwartung an Universität, Studienseminar oder Schule auch die dramatische Situation der öffentlichen Haushalte bzw. die sich daraus ergebende besondere Verpflichtung zum sparsamen Umgang mit staatlichen Finanzen in den Blick zu nehmen hat.
-
2.Eingrenzung auf das verminte Gelände von Lehrerausbildung und die beruflichen Tätigkeiten von Kunsterziehern
Bildungsinvestitionen auch im speziellen Fall der Ausbildung von Kunstlehrern sowie deren anschließende Beschäftigung müssen durch ein öffentliches Interesse begründet sein. Aussparen möchte ich in diesem Konnex die sicherlich diffizile „Legitimationsproblematik“ unserer mythenreichen Tätigkeit, gewiss, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und die Unverzichtbarkeit unserer Fachdisziplin entpuppt sich manchmal als pure Selbstdeklaration. Doch aus ihren Ambitionen abgeleitet war ästhetische Erziehung immer einer humanistischen Bildungsidee verpflichtet, die sich durch ihr Selbstverständnis der eindimensionalen Konditionierung von Wirtschaftssubjekten widersetzte. „Bildung ist stets mehr gewesen, hat stets mehr als nur den funktionalen, ökonomischen Ausbildungsaspekt bedeutet.“ (Josczok 2001, S. 33) Kunst und Kultur sind Lebensmittel, und die notwendige „Vielseitigkeit von Bildung“ (Messner 1998, S. 59ff.) einschließlich ihrer ästhetischen Dimension darf keinem kalten Zweckdenken geopfert werden. Überzeugende Begründungsversuche (vgl. Otto 1998) bestätigen mit wissenschaftlichem Scharfsinn, was die Kunstpädagogik zu leisten im Stande ist. Trotz der bildungspolitisch nicht leicht zu vermittelnden Theorielast haben sich durch den erweiterten Fokus auf eine ästhetische Rationalität die aktuellen Chancen des Faches Kunst merklich erhöht. Also weniger, weil es sich aus einer Art Selbstverteidigung als unverzichtbar darstellt (vgl. BDK 1995 u. BDK 2001), sondern eher, weil es im Anschluss an die gegenwärtig geführte bildungstheoretische Grundsatzdiskussion zur „Rahmung von PISA“ erneut als basaler Lernbereich (Benner 2002) staatlicher Bildung ausgewiesen wird. Ästhetische Erziehung wird darin sozusagen aus neutralisierter Außenbetrachtung „zum unverzichtbaren Kernbestand eines allgemeinbildenden [...] Curriculums“ (a.a.O., S. 76) für alle Schulstufen vorgeschlagen. Danach „darf kein Curriculum den Lernenden die Erfahrung und die Anstrengung dieses Blickwechsels vorenthalten und die mit seinem Vollzug möglich werdende Reflexion ersparen.“ (a.a.O., S. 74) Vom bildungsplanerischen Grundsatz her betrachtet, hat das für die Ausgestaltung des föderativen Schulwesens einen beachtlichem Stellenwert. Ob damit allerdings die zurückliegende fintenreiche Demontage des Faches Kunst wirklich gestoppt ist, das wird erst die Zukunft zeigen.
Mögliche Folgen für die Ausbildungsfrage: In allen akademischen Ausbildungsbemühungen geht es um eine systematische Vorbereitung auf eine meist langjährig währende berufliche Tätigkeit, gleich ob es sich um Informatiker, Tierärzte, Juristen – oder eben Kunsterzieher handelt. Die tatsächlichen Auswirkungen aller drei Phasen der Ausbildung als Vorbereitung auf die berufliche Handlungspraxis sind besonders in unserem Feld weitgehend unerforscht. Eine profilierte Berufsfeldforschung im Blick auf erwünschte oder erwartbare Dispositionen ist für angehende Lehrer, also auch für Kunstpädagogen, in Deutschland unbekannt. Hans Weiler spricht angesichts dieser totalen „Resistenz gegen Empirie“ von einem „unterentwickelten, brachliegenden Notstandsgebiet“ (Weiler 2002). In der Konsequenz kann auch das, was z. B. die Erste oder Zweite Ausbildungsphase de facto leisten, nicht wissenschaftlich abgesichert – oder vergleichend – beurteilt werden. Statistisch erfassbare Examensnoten beispielsweise sagen nur beschränkt etwas über tatsächliche Kompetenzen oder Qualifikationen der Kandidaten aus, lediglich die neuesten Forschungen zur Berufswahlentscheidung sind aussagekräftig – und sehr ernüchternd: „Männer suchen einen Beruf ohne Risiko, Frauen wollen Beruf und Familie verbinden können. Mit anderen Worten: In den meisten Fällen trafen sie keine bewusste Entscheidung für die Arbeit als Pädagoge.“ (Herrmann 2002, S. 76) Ob hier eine Gegensteuerung angezeigt wäre bleibt offen. Vorerst kann man im verminten Gelände von Berufsentscheidung und -vorbereitung lediglich mit vorsichtigen Annahmen, subjektiv gefärbten Erfahrungen, internationalen Vergleichen oder mit eher populärwissenschaftlichen Defizitanalysen operieren.
Was es hingegen zur Frage der Ausbildung gibt, das sind berechtigte Zweifel und eine Vielzahl von Indizien, die von unzufriedenen Novizen, irritierten Einstellungsbehörden oder von bereits im Berufsfeld tätigen, enttäuschten Lehrkräften geäußert werden. Auffallend häufig weisen sie in ihrem substanziellen Kern auf die mangelhafte Leistungsfähigkeit des vorbereitenden Ausbildungssystems hin, signifikant davon betroffen ist die Erste Phase (vgl. Neuordnung der Lehrerausbildung 1997, S. 39ff.; Kretzer 1997; Ulich 1996). Im speziellen Bezug zur Ausbildung von Kunstpädagogen wurde eine ähnliche Skepsis am pointiertesten von fünf namhaften Fachdidaktikern 1996 in Kunst+Unterricht veröffentlicht. Sie stellen in ihren Thesen im Rundumschlag zwar auch das umfassendere Restriktionsdickicht in Frage, angefangen von den ständigen Stundenkürzungen in den Bundesländern, fachfremd eingesetzten Kollegen, die geringe Organisationsbereitschaft der Kunsterzieher et cetera, doch konzentrieren sie ihr Unbehagen besonders auf die hier angesprochenen „gravierenden Mängel der universitären Ausbildung“, z.B. die Umwidmung von Hochschulstellen aus Gründen des Einsparens von Personalkosten oder auf die grottenschlechte fachdidaktische Vorbereitung von Studierenden an mancher Kunsthochschule (K+U, Kunstdidaktischer Diskurs 1996).
Bleiben wir bei der eindringlich vorgetragenen, generellen Kritik der wissenschaftlichen Lehrerausbildung, die sich nach Ansicht vieler Fachleute nahtlos auf die kunstpädagogische Ausbildung übertragen lässt. Denn allgemein kann man für diese Ausbildungsphase konstatieren, dass eine gewaltige Kluft besteht zwischen den universitären Ansprüchen mit ihren Wirkungshoffnungen auf der einen Seite und dem tatsächlichen Agieren im Beruf auf der anderen, die Tradierung von Erfahrungswissen und Handlungsroutinen erweisen sich in immer größerem Ausmaß als ungeeignet, die anstehenden Anforderungen zu bewältigen. Zugespitzt: Die später ausgeübten Tätigkeiten und die von ihrem Selbstverständnis her prononciert vertretene Vorbereitung auf sie hat faktisch nur entfernt etwas miteinander zu tun, weil „das Konzept eines handlungsleitenden Wissens hinter dem Können, das zu suchen und zu vermitteln sich lohnt, in der realistischen Denkart ebenso wenig aufgegeben wird wie der Traum von der akademischen Herstellbarkeit professioneller Handlungskompetenz. Das Können des Lehrers, so meint man, ist im Prinzip durch das Konstrukt des Wissens vollständig beschrieben – und es ist dann verführerisch zu glauben, man müsse es auch `in den Kopf` eines Novizen bringen. ... Das spätere Können stellt sich dann gewissermaßen als bloß unbewusste Variante dessen dar, was dem Lerner anfangs explizit vermittelt wurde.“ (Neuweg 2002, S. 17) Fast zwangsläufig resultiert aus dieser Sicht eher eine optimistische Zuversicht denn ein fundiertes Wissen um die Wirkmächtigkeit zeitaufwändig akkumulierter akademischer oder künstlerischer Lehrinhalte, die demnach zeitlich unbestimmt also irgendwann in der späteren Berufsbiografie die nötigen Alltagskompetenzen entfalten sollen. Freilich dürfen die beiden analytischen Konstrukte „Wissen“ und „Können“ auch nicht isoliert voneinander gesehen werden, denn jede profunde Praxis ist gleichsam durch theoretisches Wissen „imprägniert“, so wie jedes Wissen zumeist gleichzeitig Anteile von erfahrungsbezogenem Handeln in sich birgt. Auch um Missverständnissen vorzubeugen: Die Auseinandersetzung mit grundständig anzubietenden Bezugswissenschaften der Künste, die Kenntnis bestimmter Theorien und notwendiger Wissensbestände sind unverzichtbarer Bestandteil des akademischen Studiums. Doch es geht um die systembedingten Benachteiligungen der Studierenden eines Lehramtes, weniger um die Frage der Qualifizierung von Fachwissenschaftlern. Die Übersetzung des Professionswissens ist aus dieser Perspektive jedenfalls bisher nicht Sache der Ausbildung, sondern des angepeilten späteren Berufsalltags, der im Studium auf merkwürdige Weise konturenarm und blass bleibt. Folglich stellt sich die Frage, wie Elemente des später handlungskonstituierenden Wissens es zeigt sich im Dialog mit Schülern, in der Lehrkunst eines guten Unterrichts, im Schulbetrieb generell in das Studium integriert werden können. Eiko Jürgens verwies in diesem Zusammenhang auf die „begabungstheoretische Schere im Kopf“ besonders der Gymnasiallehrer, denn gerade in ihrer Ausbildungstradition haben andere Studieninhalte als die eng fachlich bezogenen wenig Raum: „Während des Studiums wird auf Grund der unterschiedlichen Studieninhalte dem Grundschullehrer eingetrichtert, dass Fachwissen für ihn nicht so wichtig sei wie für den Gymnasiallehrer und zu viel Fachwissen ihn möglicherweise intellektuell überfordern würde, deshalb sollte man ihnen mehr leichte Kost in Form von mehr Pädagogik verabreichen. Dem Gymnasiallehrer wird hingegen eingeschärft, je mehr Fachwissen angehäuft werden kann, desto mehr `Lehrer´ (sei) er, Pädagogik und Didaktik stören da nur, sind leidliches Beiwerk.“ (FR Nr. 83, vom 10.04.2002) Der Verfasser reflektiert damit ein auch für uns zutreffendes weit verbreitetes Grundmuster der abgespaltenen Ausbildung zum Kunstpädagogen, das noch vielerorts vehement verteidigt wird. Daher gleicht das in unserem Metier institutionell separierte Wissen abseits von berufsfeldbezogenen Erfahrungszusammenhängen manchmal einer Camera obscura, denn unter dem Deckmantel einer sorgsam gepflegten Abschottung oder ideologisch verbrämten „Freiheit der Lehre“ erscheint es nahezu beliebig, was in den Ausbildungszielen für angehende Kunsterzieher vor-, ab- und festgeschrieben wird. Angesichts dieser vermeintlichen „Freiheit“, die sich in Wahrheit als chaotischer Wildwuchs beliebiger Ausbildungsgehalte offenbart, mit denen man im modernen Jargon kunstvoll zu jonglieren versteht, wird der Feldkontakt gezielt ausgespart. Auch ist angesichts mehr und mehr geregelter Studienzeiten viel Überflüssiges darunter, doch „es ist nicht nur die Quantität der Veranstaltungen, auch die hohe thematische Beliebigkeit und fehlende Sequentialität werden häufig kritisiert.“ (Huwendiek 1999, S. 47)
In der nüchternen Diagnose dieser „Flucht aus der Verantwortung“ sind sich viele kritische Stimmen seit geraumer Zeit einig. Dazu noch einmal die Stimmen der zitierten Kritiker: „Zu viele Fachdidaktiker scheinen derzeit fachdidaktische Theoriebildung nicht mehr als Zentrum ihrer Arbeit anzusehen, ja, manche lehren sie nicht einmal mehr. Sie vermeiden es nicht selten, ihr eigenes Arbeitsfeld, die Schule, aufzusuchen. Sie sind eher an der Herstellung weniger verbindlicher Praxen interessiert, sei es die Malpraxis im eigenen Atelier, seien es Fluchträume für Studierende. ... Viele Hochschullehrer verzichten auf Didaktik. Sie privatisieren oder fliehen nicht selten in künstlerische Selbstverwirklichung, Kunstgeschichte oder Therapiekurse. Nachdem sie den Kontakt zur Praxis des Unterrichtens aufgegeben haben, sind ihre Aussagen über die Praxis weder glaubhaft, noch können sie durch Schulkritik aus der Ferne Orientierung für [angehende, W.S.] Lehrerinnen und Lehrer bieten, geschweige denn Stütze oder Korrektur der Praxis sein.“ (S. 23 u. 25) In anderen Quellen zu diesem Desaster werden die „typischen Einäugigkeiten (mancher) fachlichen Position“ beklagt, oder auch „die gänzliche Untauglichkeit bestimmter Theoriebildungen“ mit ihren irrelevanten „Wahrheitsbehauptungen und Bildungsanforderungen in den blauen Himmel“ – bis hin zu der provokanten Forderung, auf schulbezogene Kunstdidaktik ganz zu verzichten (Selle 1990, S. 38f.) Unsere Fachliteratur ist voll von solch resignativen, manchmal auch mit einer Portion Eitelkeit vorgeführten Eiertänzen. „Fachdidaktiker scheinen ihre Paradigmen so häufig zu wechseln wie ihr Hemd. Bevor Theorie in der Praxis überprüft werden kann, wird diese in der Regel verlassen.“ (K+U, a.a.O., S. 23) Wohl nur meine Nestzugehörigkeit gebietet es, hier kein Klagelied von der Kasseler Kunstakademie und ihrer völlig desolaten Kunsterzieher-Ausbildung anzustimmen.
3. Qualitative Weiterentwicklung
So wie in der aufgezeigten Problembeschreibung disparate Elemente der Lehrerausbildung und im alternativen „Modernitätsparadigma“ ein integrales, d. h. Aufwand und Nutzen austarierendes Konzept der Lehrerbildung vorgeschlagen wurde, das die höchst komplexe Professionalität on the job als favorisiertes Grundprinzip aller Berufsvorbereitung anerkennt, ist die bestehende, gelegentlich willkürliche Parzellierung in voneinander losgelöste oder in ihrem Berufsbezug unbegründete Ausbildungselemente zu überwinden. Es geht hierbei weder um eine Zustimmung zur Abschaffung bewährter Strukturen noch um die einäugige Alltagsbetonung zu Gunsten einer völligen Neuformierung der Lehrerbildung, sondern lediglich um eine sinnvollere Anbindung der verschiedenen Ausbildungssegmente an die Erfordernisse des Arbeitsfeldes. Um eine inhaltliche Kontinuität sicherzustellen, „ist eine funktionale Arbeitsteilung zwischen ihren drei Phasen und Institutionen notwendig, die den schulischen sowie ausbildungs- und berufspraktischen Erfahrungsunterschieden [...] Rechnung trägt.“ (Kemper 1996, S. 44) Qualitative Lehrerbildung wird dabei inzwischen „als eine übergreifende berufsbiografische Aufgabe ... betrachtet“ (Terhart 2000, S. 20), die sich neben ihrem Augenmerk auf eine von Beginn an entwickelnde Berufskompetenz prozessual auf den fassettenreichen Aktionsradius der ausgeübten Tätigkeiten und deren möglichst langfristige Ausübung bezieht. Dieses erweiterte Verständnis berufsbiografischer Entwicklung schließt das stetige Weiterlernen, also Fort- und Weiterbildung, Supervision oder, wie es ein soeben veröffentlichter Kasseler Forschungsbericht (Wollring 2003) vorschlägt, regelmäßige „Updates“ in Form hilfreicher Zwischenstudien für bereits länger praktizierende Lehrkräfte ein. Schule definiert sich seit einiger Zeit als lernendes System, denn Lehrer- und Schülerrollen ändern sich gegenwärtig gründlich, aus eher komplementären werden symmetrische Beziehungen, aus Hierarchien werden Netzwerke der Kooperation. „Die Schule hat keinen Sonderstatus mehr, sie ist keine hoheitliche Institution, die sich der Einsicht von außen verschließen kann. Schulen werden beobachtet, und je besser und offensiver sie mit den Außenwahrnehmungen umgehen, desto mehr können sie sich als klient-orientierte – und insofern effiziente – Organisationen darstellen.“ (Oelkers 1997, S. 36) Doch nach wie vor ist der störanfällige Berufsalltag dominiert durch den pädagogische Umgang mit unterschiedlich motivierten Schülern im professionellen Handeln liegt die Anforderung, ihnen gerecht zu werden, also primär an einen fachlich und methodisch versierten Unterricht, der klare Ziele verfolgt, gleichzeitig die Selbsttätigkeit der Kinder und Jugendlichen im Lernen fördert und sich gewissermaßen ständig selbst reflektiert und korrigiert. Im weit gehenden Unterschied zu fast allen anderen Tätigkeiten kann dabei „selbst für die erfahrensten Lehrerinnen und Lehrer der Berufsalltag nicht zum Routinehandeln werden. Sie haben es immer wieder mit anderen Schülern zu tun; ihre ´Klientel´ ist wechselnd. Ältere Schüler werden entlassen, jüngere neu aufgenommen. Und auch in den Schulklassen ... kommt es tagtäglich zu Situationen, in denen improvisiert werden muss, ... keine Stunde (gleicht) einer anderen. Lehrerarbeit ist überkomplex.“ (Rolff 1992) Neben Wissenserwerb und schülerzentrierten Lernstrategien, einem vergrößerten Methodenrepertoire und einer fachspezifischen Reflexionskultur bezieht sich qualitative Schulentwicklung darüber hinaus auf die sich inzwischen ablesbar wandelnden Institutionen des Bildungswesens [selbst], die dem erzieherischen und fachspezifischen Handeln gemeinsam mit Kollegen, Teams, Leitungspersonen, Eltern oder außerschulischen Partnern einen erweiterten Aktionsraum ermöglichen. Ein solchermaßen veränderter Referenzrahmen von innovativer Schulentwicklung umreißt das fassettenreiche Beziehungsgeflecht einer autonomen, selbstverantwortlich „lernenden Organisation“, in deren Zentrum humanistische Ansprüche an eine Bildung von Kindern und Jugendlichen mit all ihren Lernfähigkeiten, emotionalen Bedürfnissen und unterschiedlichen Wünschen stehen (vgl. Rolff/Fischer 1997, Messner 1998). Die meisten revidierten Schulgesetze der Länder fordern inzwischen von allen Beteiligten die aktive Gestaltung ihres Schullebens in Form der Herausbildung eigener Programme mit gemeinsam entwickelten Schwerpunkten und Profilen. Freilich orientieren sich autonome Schulen weiterhin an staatlich verantworteten Normen, Standards oder Rahmencurricula, die öffentlich Auskunft darüber geben, wie und ob die Beteiligten Verantwortung für bestimmte Lernergebnisse übernehmen und die gemeinsam festgelegten Bildungsziele intelligent einlösen. Schon aus diesem Grund werden in zukünftigen Schulen „Qualitätskontrollen“ ihrer geleisteten Arbeit qua Evaluation oder Leistungsvergleich à la PISA vermutlich zum Alltag gehören, nicht zuletzt aus Gründen der eingangs dargelegten externen Leistungsanforderungen. Gefordert ist allerdings eine bildungspolitische Qualitätsdebatte im pädagogischen Sinne, keine, die nur auf simple Überprüfungen reproduktiven Wissens oder auf „Rankings“ reduziert ist. Dieser „Entwicklungsaspekt ist deshalb so wichtig, weil Qualität nicht nur geprüft, sondern vor allem erzeugt werden muss.“ (Rolff 1998, S. 7)
4. Professionalität und berufliche Anforderungen an Kunstpädagogen
„Neue Lehrer braucht das Land!“ – das war der griffige Slogan eines Hamburger Schulreformers Mitte der 90-er Jahre. Folgt man Peter Struck, dann hätte der beamtete, stoffvermittelnde „Stundengeber“ ausgedient, doch seine den damaligen gesellschaftlichen Missständen angepassten Lösungsstrategien verraten auch eine nicht widerspruchsfreie Tendenz zur Sozialpädagogisierung der Schule. Nicht nur auf Grund des Widerstands eher traditionsorientierter Opponenten (Giesecke 1996) ist man inzwischen bescheidener geworden, und Schulreformer besinnen sich viel realistischer als früher auf vorgegebene Zielvereinbarungen. Klar, dass mit der Forderung einer Strukturreform und Dynamisierung des gesamten Bildungspersonals auch die antiquierte universitäre Lehrerausbildung ins Kreuzfeuer der Kritik geriet. Struck bezeichnete sie damals als „das rückständigste Element von Schule. Die Ausbildung ist heillos unzeitgemäß. Sie leidet an fachwissenschaftlicher Überbetonung, sie erstickt in pädagogisch irrelevantem Detailwissen. In den entscheidenden Fähigkeiten ... sind viele Lehrer Analphabeten. Vom Stundengeber und Transporteur von Wissen müsste sich der Lehrer zum Lernberater, vom reparierenden Erzieher zum präventiv wirkenden Coach wandeln.“ (Struck 1997) Die bekannten vielstimmigen Defizitanalysen münden primär in die Forderung nach einer Anschlussfähigkeit des Studiums, Dreh- und Angelpunkt ist darin ebenfalls die zuvor erläuterte Zielperspektive qualitativer Schulentwicklung einschließlich ihrer personalen Leitvorstellungen. An ihr sollte sich verstärkt auch der staatlich zu verantwortende Auftrag zur Ausbildung von Kunstpädagogen messen. In der Denkschrift der Bildungskommission NRW, die nach den aufmerksam rezipierten Schweizer Vorstößen in Deutschland eine gewisse Pilotfunktion in der aufgeworfenen Diskussion um ein verändertes berufliches „Leitbild von Lehrerinnen und Lehrern“ (1995, S. 303 ff.) übernahm, wird die Richtungsänderung präzisiert: Zu den schon genannten pädagogischen und persönlichen Voraussetzungen zur Bewältigung einer partnerschaftlichen Schulentwicklung treten bestimmte „Basiskomponenten dieses Leitbildes ...: fachliche und didaktische Kompetenz, Methodenkompetenz, Menschenführung, diagnostische Kompetenz, Beratungskompetenz, metakognitive Kompetenz, Medienkompetenz, Kooperations- und Teamfähigkeit. Sie plädiert für eine konsequente Ausrichtung künftiger Lehrerbildung an diesem beruflichen Leitbild.“ (Jung 1997, S. 27)
In der Serie zur „Zukunft der Schule“ in der SZ skizziert Johannes Kirschenmann das Bild eines zeitgemäßen Kunsterziehers: „Guter Kunstunterricht braucht Lehrer, die das Eigensinnige der Kunst, den ästhetischen Möglichkeitsraum im Machen und Denken, in einem künstlerischen Studium erfahren haben. Doch es genügt nicht, sich als Künstler zu verstehen, den der wärmende Beamtenrock vor dem rauen Klima des Kunstmarktes schützt. Zum Kunstpädagogen braucht es die Vermittlungskunst, die Didaktik. Kunstdidaktik, im Studium für das Lehramt in der Sekundarstufe I ... selbstverständlich ..., ist an vielen Kunsthochschulen, wo die Gymnasiallehrer ausgebildet werden, das Schmuddelkind.“ Daraus bilanziert er: „Die Vermittlungskunst im Studium muss gestärkt werden, frühe und gut begleitete Praktika sensibilisieren für den anspruchsvollen Lehrberuf. Ziel ist ein Lernen als Wissens-, Handlungs- und Kompetenzzuwachs aus Unterrichtsprojekten heraus, die in vielfältigen Berührungspunkten mit dem außerschulischen Ernstfall verknüpft sind.“ (Kirschenmann 2002)
Das Plädoyer für eine berufsfeldbezogene erste Ausbildungsphase und die doppeldeutige Anspielung auf einzufordernde „Vermittlungskünste“ führt über das bloße Lamento hinaus, denn es deckt sich weitgehend mit neueren erziehungswissenschaftlichen bzw. schultheoretischen Entwicklungsforderungen, die sich an den inzwischen häufig publizierten Eckpunkten einer veränderten gesamtgesellschaftlichen Erwartung an Schule, Bildung und Lernprozessen ausrichten (Bessoth/Weibel 2000; Horster/Rolff 2001; Terhart 2002). Schluss mit den Eiertänzen um die Staffelei im Zeichensaal. Insbesondere die aktuelle Kunstdidaktik muss sich von bombastisch hochstilisierten Ansätzen lösen, die versuchen, das didaktisch Gesicherte zu verwässern. Hierzu zählt beispielsweise auch die leidige Erbsenzählerei, ob mehr das Künstlerische oder das Pädagogische die Profession bestimmen sollen. Wenn es keine neuen Antworten zu diesem Thema geben kann, dann geht es weiterhin um Offenheit und das Aushalten von Widersprüchen. Folglich steht im Mittelpunkt des hier relevanten kategorialen Rahmens kaum der schwierige Job des Künstlers oder eine mögliche Freizeitbeschäftigung, sondern allein die stabile Persönlichkeit des Lehrers als vertrauenswürdige, psychisch und physisch belastbare und natürlich fachkompetente Bezugsperson für Kinder und Jugendliche. Nicht erst seit den Impulsen durch TIMSS oder PISA zeigt die neuere Forschung, dass sich vor allen anderen Erwartungen die „Qualität eines Lehrers ... an der Qualität seines Unterrichts (misst); Schulqualität entsteht zu einem hohen Anteil aus Unterrichtsqualität.“ (Terhart 2002, S. 99) Folglich muß eine zeitgemäße ästhetische Erziehung „mehr sein als ein modisches Gewand für den alten Schlendrian. Kein Lehrer muss bei seiner Unterrichtsplanung seine Bezugsliteratur herbeten können; doch sollte das komplexe Bewusstsein des didaktischen Anspruchs von Ästhetischer Erziehung ihm jederzeit gegenwärtig sein. Denn Theorie ist nicht Verlegenheitslegitimation, sondern Einsicht in den Begründungszusammenhang von Praxis.“ (Schütz 1998, S. 9) Unser Fach lebt von seinem vielschichtigen „knowing how“, lebendigen Arrangements, seinen sicht- und vorzeigbaren Lernergebnissen, aber auch von angeeignetem Wissen und wahrgenommenem Können. Gerade die oft beschriebene Bildung von Relationen zwischen ästhetischem Produzieren und seine Reflexion lässt sich unter diesem Vorverständnis zur Sprache bringen. Dazu gehören freilich auch Misserfolge und offensichtliche Fehlsteuerungen in Lernprozessen, die manchmal in der ungeeigneten Lehrkraft begründet sein können (vgl. Rittelmeyer 2000).
Ausgehend von diesen erweiterten beruflichen Akzentuierungen und notwendigen professionellen Kompetenzen im Sinne qualitativer Schulentwicklung gehört der isolierte Einzelkämpfer endgültig der Vergangenheit an. Professionelle Kunstpädagogen vertreten herkömmlichen Fachunterricht ebenso wie schülerzentrierte oder interdisziplinäre Arbeitsformen (Schütz 1998), sie arbeiten mit anderen in Teams zusammen, sind kooperationsfähig und nicht nur durchs Internet mit vielen inner- und außerschulischen Partnern „vernetzt“. Letztendlich erfahren sie hautnah an sich selbst, dass geübte Formen des Austausches und einer geschickten Arbeitsteilung sehr entlastend für die alltäglichen Routinen sein können. Manche Schulen bilden inzwischen Netzwerke zum Erfahrungsaustausch und geben ihre Kompetenzen an andere weiter. Die ästhetische Erziehung bietet gegenüber manch anderem Schulfach unschätzbare Vorteile, denn seit langem gehören werkstattähnliche Methoden oder interdisziplinäre Lernarrangements in Museen, Ausstellungen, Ateliers oder Orten der Architektur zum Repertoire eines anspruchsvollen, lebendigen Unterrichts, also lange bevor die sogenannten „außerschulischen Lernorte“ von der neueren Schultheorie und ihren Programmen aufgegriffen wurden (Stehr 2001).
-
5. Qualifizierung von Studierenden und der Stellenwert
schulpraktischer Studien
Die eingangs zitierten Untersuchungen und Kommissionsberichte zur Reform der Lehrerbildung gehen ausnahmslos von den Prämissen eines wissenschaftlichen Studiums aus, „ein solides systematisch, methodisch und wissenschaftsgeschichtlich gestütztes Wissen in den und über die Unterrichtsfächer(n) ist eine conditio sine qua non. ... Hierbei ist das Disziplinen- bzw. Fächerwissen, das die Universität an Lehramtsstudierende vermittelt, deutlicher als bisher auf die Horizonte der schulischen Lehrpläne zu beziehen.“ Darüber hinaus wird bekräftigt, „dass Professionalität im Lehrerberuf zuallererst ein berufsbiografisches Entwicklungsproblem ist“ (KMK 1998) und dass das Studium insbesondere dem Aufbau einer professionellen Wissens- und Reflexionsbasis dient. Aus diesen Überlegungen ergeben sich plausible Konsequenzen für die Strukturreform dieser Phase, auf die vorn bereits im Blick auf die veränderten Perspektiven der Schulentwicklung hingewiesen wurde, auch im Unterschied zur Herausbildung eines bisher dominanten Selbstverständnisses als „reiner Fachwissenschaftler“, Künstler, Sportler, Naturwissenschaftler et cetera. Demzufolge kommt es im Rahmen der gezielten Rückbindung an schulcurriculare Empfehlungen (vgl. u.a. KMK-Vorgaben für die gymnasiale Oberstufe) darauf an, schon im Studium für jenen „doppelten Habitus“ zu sensibilisieren, der versucht, Wissenschaftsbezüge ansatzweise mit jenen des praktischen Könnens zu verbinden. Für die Lehrerausbildung bieten sich hier unterschiedlichste Vorbilder (vgl. Oser/Oelkers 2001) und gute Erfahrungen mit schulpraktischen Studien oder Praktika an, in denen eine wissenschaftlich angeleitete, theoretische und fallverstehende Reflexivität im Vordergrund steht. „Die wissenschaftliche Reflexivität als ein Strukturmerkmal des Lehrerhandelns, muss sich gleichermaßen auf die fachwissenschaftlichen Bezüge und die erziehungswissenschaftlichen, psychologischen und bildungssoziologischen Grundlagen beziehen. Jede Entscheidung, die zu Lasten der erziehungswissenschaftlichen Reflexivität und der reflexiven Vermittlung zwischen Person und Sache, also Fach und Pädagogik in pädagogischen Prozessen geht, nimmt in Kauf, dass ein konstitutives Moment des professionellen Lehrerhabitus unentfaltet bleibt. Es geht somit um die Sicherung einer selbstständigen, reflektierten Wissens- und Kompetenzverwendung durch Lehrer in komplexen, offenen pädagogischen Handlungssituationen.“ (Combe et al, 2001)
Besonders auch der KMK-Abschlussbericht von 1998, der alle Phasen der Lehrerausbildung unter die Lupe nimmt, bestärkt einen pragmatischen Konsens der Bundesländer, indem er „substantielle Kernkompetenzen“ für den Abschluss der ersten Phase nennt: „Die Kommission betrachtet die gezielte Planung, Organisation, Gestaltung und Reflexion von Lehr-/ Lernprozessen als Kernbereich der Kompetenz von Lehrkräften. Dieser übergeordneten Aufgabe entsprechen die Kompetenzen Unterrichten, Erziehen, Diagnostizieren – Beurteilen – Beraten sowie die berufliche Kompetenz, Schule zu entwickeln. Insofern versteht die Kommission Lehrkräfte als Experten für Lehren und Lernen – wobei dies das eigene kontinuierliche Weiterlernen im Beruf mit umfasst.“ (KMK-Bericht 1998) In einer hochschuldidaktischen Reformulierung dieses Ansatzes stünde die Ausbildung von Kunstpädagogen vor der Aufgabe, das jeweilige professionelle Wissen, sei es als „subjektive Theorie“, als „Logik der Praxis“ (Bourdieu) oder als „Deutungsmuster“ konzeptualisiert, zur Sprache zu bringen, jedenfalls wenn es im späteren beruflichen Alltagshandeln darauf ankommt, innerhalb der verfügbaren Theoriebestände zwischen wissenschaftlichem Wissen und situativer Anwendung zu unterscheiden. In der Logik des reflexiven Ansatzes liegt der lebendige Bezug zu Schule und Unterricht begründet; folglich sind im Rahmen der fachwissenschaftlichen Grundstudien Veranstaltungen zu konzipieren, die über eine lediglich auf dem Trockenen betriebene, nur theoriefixierte fachdidaktische Perspektive ergänzt werden durch offene, interdisziplinäre, mehr erziehungswissenschaftlich, entwicklungspsychologisch oder berufspraktisch ausgerichtete Zugriffe. Vorn wurde das Amalgam aus „Wissen“ und „Können“ begrifflich unterschieden; folglich kann in den Begegnungen mit „wirklichen Handlungssituationen dann die Einsicht wachsen, dass es im Unterrichtsgeschehen Faktoren gibt, die man erfahren muss, weil Worte sie nicht beschreiben können“. (Neuweg 2002, S. 24) Präzis reflektierte Beobachtungen parallel zu authentischen Erfahrungen im gewählten Berufsfeld, die eben bewusst über die vorwissenschaftlich geprägte individuelle Sichtweise hinausreichen, sind für angehende Lehrkräfte ein wertvoller Experimentier- und Erfahrungsraum. Nicht zu unterschätzen ist, dass ein solchermaßen bestärkender oder desillusionierender Einblick in den rauen Schulalltag zugleich auch der psychologischen Selbstklärung der Studierenden dient. Der berüchtigte „Praxisschock“, ohnehin mehr universitäre Legende als Tatsache, dürfte damit endgültig von der Bildfläche verschwinden.
Bei allen offenen Praxiserfahrungen ist es übrigens einerlei, ob die Unterrichtsszenarien von Studenten, Referendaren, gestandenen Routiniers oder Hochschulangehörigen zur Diskussion gestellt werden. Novizen im Studium werden es mit großer Freude zur Kenntnis nehmen, dass sich ein Experte aus Baden-Württemberg nicht nur für „die Fachdidaktik als die eigentliche `Zunft´ der Lehrpersonen“ verwendet, sondern zugleich fordert: „Für die Fachdidaktiker sind Erfahrungen aus eigener Unterrichtstätigkeit sicherlich unverzichtbar. Es wäre darüber hinaus aber grundsätzlich nötig, dass sie auch schon einmal im Gymnasium unterrichtet hätten, und es wäre natürlich noch besser, wenn es noch nicht so furchtbar lange her wäre oder sich sogar regelmäßig wiederholen könnte.“ (Huwendiek 1999, S. 46) Den innovativen Lösungen aller Beteiligten dürften keine Grenzen gesetzt sein, fachdidaktische Stellen an den Hochschulen sollten, wie von vielen Experten vorgeschlagen, reichhaltige schulpraktische Erfahrungen voraussetzen und grundsätzlich, wie in anderen Ländern erfolgreich praktiziert, nur auf Zeit vergeben werden (Oelkers 1999), damit nicht „die Gestaltung eines Faches an der betreffenden Hochschule für die nächsten 20 bis 30 Jahre“ (Kästner 2001, S. 37) durch Versorgungsfälle oder die monierten Fehlentwicklungen blockiert wird.
Was ist kurz- und mittelfristig realisierbar? In einem ersten Schritt zielen Reformvorhaben, wie sie die KMK-Kommission vorschlägt, auf das „Ende der Beliebigkeit für Lehrende und Lernende in beiden Ausbildungsphasen“. Sie berücksichtigen das „Betriebswissen“ der bereits im Berufsfeld tätigen viel intensiver als bisher, weil es für den beruflichen Klärungsprozess hilfreich ist und zugleich einer kooperativen Verständigung über Mindesterwartungen oder bestimmte Standards (vgl. Oser 2001) den Weg ebnen könnte. Die an die erste Phase adressierte Erwartung lautet: Was müssen Lehrkräfte heute am Ende ihrer Erstausbildung können und woran kann man erkennen, dass sie es können? Mittelfristig zu fokussieren sind für die universitäre Phase mit einer Stärkung und klaren Verortung von Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften bestimmte „Absolventenstandards“, wie sie mehrere Expertisen vorschlagen (vgl. Oser/Oelkers 2001, S. 216ff. u. Terhart 2002, S. 35/36). Fruchtbare Erfahrungen wurden mit sog. „runden Tischen“ oder institutionalisierten Kooperationsräten gesammelt. Dazu müssen sowohl von Seiten der Hochschule als auch von den Studienseminaren bzw. anderen beteiligten Institutionen (Schulämter, Bezirksregierungen, Fortbildung) entsprechende Voraussetzungen hinsichtlich angemessener personeller Ressourcen sowie einer funktionalen Infrastruktur erfüllt werden.
Ob die Universität bzw. die Kunstakademie angesichts des berüchtigten „Tiefflugs der Eule“, also jenes häufig dahin dümpelnden, fachdidaktisch saturierten Lehrbetriebs, der in seinen heimlichen Sozialisationswirkungen überhaupt nicht vorbildlich oder innovativ wirkt (vgl. Arnold/Schüßler 1998, S. 49ff.), leisten kann, was von ihr gefordert wird, ist zu bezweifeln. Besonders bei den „Künstlern“ ist die Bereitschaft Einwände zu ertragen und Argumente zur Kenntnis zu nehmen, generell schwach ausgeprägt. Sicherlich werden sich einige Probleme gerontologisch selbst erledigen, andere fordern die Unterstützung der betroffenen Studenten ebenso wie jene der zuständigen Hochschulverwaltungen, Ministerien und Fakultäten. Denn die Zukunftsentwicklung wird zu kooperativen Formen führen müssen, weil die Systemveränderung dies fordert, nicht, weil es aktueller politischer Wille ist oder ein vermeintlich modischer Trend allgemeiner Schulverdrossenheit dieses nur als Wunsch anmeldet. Begleitende Beratung, realistisches Umdenken, Evaluation der Veranstaltungsangebote, Forschung zur Lehre an den Hochschulen und zur Lehrerprofessionalität, so wie es von vielen Experten seit langem gefordert wird (Hänsel 1996, S. 98, Weiler 2002), wirkt gleichermaßen als Innovations- und Klärungsprozess.
6. Zweite Phase - Integration in den Schulbetrieb
Begonnen im neunzehnten Jahrhundert, hat sich die von vielen ungeliebte zweite Phase der Lehrerbildung in Deutschland trotz ihrer völlig ungeklärten und wenig erforschten Auswirkungen auf die individuelle Berufsentwicklung von Lehrern systemisch am Leben erhalten können. Obwohl erfolgreiche Schulsysteme anderer Nationen den Vorbereitungsdienst unserer Prägung überhaupt nicht kennen und radikale Empfehlungen ihn am liebsten abschaffen würden (vgl. Heinrich-Böll-Stiftung 2002), wird er dennoch, freilich in reformierter KMK-Struktur, weiterhin existieren. Darin sind sich die meisten Expertisen einig, jedoch unterliegen „die Institutionen und Programme der zweiten Phase ... einer ähnlich starken Kritik wie diejenigen der ersten Phase; jedenfalls wäre es inadäquat, bei der Evaluation von Lehrerbildung immer nur die Universitäten in den Blick zu nehmen.“ (Terhart 2002, S. 41)
Im Unterschied zur universitären Studienphase ist der Vorbereitungsdienst in den meisten Bundesländern konserviert als klassische top-down-Systemsteuerung durch die zuständigen Bildungsministerien haarklein verrechtlicht und durch entsprechende Ausbildungsverordnungen, Prüfungsbestimmungen und hürdenreiche Vorschriften geregelt. Formalrechtlich reichen die bürokratischen Tentakeln der Bezirksregierungen, Schulämter oder Ministerialabteilungen zumeist bis in die Studienseminare hinein und versuchen durch ihre Aufsichtsgebärden die Einhaltung landesweiter Spielregeln zu gewährleisten. In Abweichung zum universitären Bescheinigungssystem, „zur Inflation der Spitzenzensuren“ wissenschaftlicher Examina und Zertifizierungen (vgl. Wissenschaftsrat 2003), die allesamt über die Berufstauglichkeit der Kandidaten substanziell wenig aussagen, verfügt die zweite Phase über ein recht eng gestricktes Netz von persönlichen Beratungen, Leistungsgutachten und Servicediensten, die formell zum ersten Mal in der Berufsbiografie angehender Lehrkräfte eine mutmaßliche Berufstauglichkeit durch das zweite Examen attestieren. Durch das staatliche Ausbildungsmonopol, das zwar wie ein verkalkter, aber dennoch durchlässiger Filter arbeitet, wird in der zweiten Phase de facto entschieden, ob die begonnene Berufstätigkeit im Beamtenrock fortgesetzt werden darf oder nicht. Ob dieses Konstrukt zum Zweck der Beobachtung und Auslese mehr der staatlichen Selbstillusionierung oder tatsächlich der beruflichen Qualifizierung dient, das sei dahin gestellt. Kinder, Jugendliche und Eltern haben hingegen ein Recht auf gute Lehrer, warum sollte das Verfassungsgebot staatlicher Schulaufsicht diesen Einfluss aufgeben?
Die Sonnenseite dieses Systems bildet dort, wo es weitab formalistischer Engführung gut funktioniert, eine zweckrationale Struktur. In Hessen beispielsweise werden kooperativ mit den verschiedenen Ausbildern Seminare konzipiert, die praxisnah den Unterricht flankieren. Von ihrem Selbstverständnis her bilden sie neben den obligatorischen Unterrichtsberatungen eine Art Service zwischen den eigenverantwortlichen, stundenmäßig nicht unerheblichen Unterrichtsverpflichtungen und den Erfahrungen als Lehrkraft mit zunächst ungewohnten und vielfältigen Rollenansprüchen. Analog zur Berufseinführung dienen die Seminare der Unterrichts- und Personalentwicklung gleichermaßen, indem sie eine wissenschaftlich untermauerte Reflexion aufgreifen, die als dialogisches Prinzip den Schulalltag begleitet und z.B. als Unterrichtsbeobachtung, Hospitationsunterricht, Servicedienst oder als Kooperation mit Mentoren angelegt sein kann. Darüber hinaus setzen sich Einzelberatungen nach Unterrichtsbesuchen intensiv mit den Lerndispositionen der Schülerinnen und Schüler auseinander und schenken der Förderung lernschwächerer Schüler – nicht erst seit PISA – allergrößte Aufmerksamkeit. Auch den Ausbildungsschulen erwachsen dort, wo es günstig verläuft, vielerlei Vorteile aus der engen Zusammenarbeit. Nicht allein, dass über diesen Weg universitäres, neueres Wissen in die Schulen „importiert“ wird, auch alternative und zeitgemäße Lehr- und Lernmethoden oder originelle Planungskonzepte liefern fruchtbare Impulse für die interne Schulentwicklung. Nicht selten werden leistungsstarke Referendare unmittelbar nach dem Vorbereitungsdienst von interessierten Schulen angeheuert.
Diese etwas sonnigen, sicherlich auch nur punktuell gewonnenen Eindrücke sollen nicht verhehlen, dass auch die zweite Phase gravierende Schwachstellen aufweist und dringend reformbedürftig ist; verschiedene Gutachter und Kommissionen schlagen daher eine Vielzahl von Optimierungen und wünschenswerten Veränderungen vor.
Kritik entzündet sich vor allem an der Selbstherrlichkeit vieler Ausbilder oder ihrem manchmal überholten Unterrichtsverständnis, das weder von zeitgemäßen lerntheoretischen Prämissen ausgeht, noch von der fachlichen Seite her up to date ist. Kein Lehramtsanwärter darf sich seine Betreuer aussuchen; hinzu kommt die problematische Vermischung von „Beratung“ und „Beurteilung“. (Terhart 1999, S. 13) Zu prüfen und zu erproben wäre, ob sich diese verschiedenen Aufgabenbereiche nicht voneinander trennen lassen. Pragmatische Lösungen zielen u.a. auf den Verzicht des Rituals der zweiten Staatsprüfung und fordern statt dessen einen aussagekräftigen Würdigungsbericht oder ein Portfolio, das instruktiv über den Werdegang und die Aktivitäten des Junglehrers Auskunft gibt. In den zitierten „Standards für die Lehrerausbildung“ werden zehn sog. Absolventenstandards (Terhart 2002, S. 35f.) vorgeschlagen, die sich praxisorientiert und schulnah an den vielfältigen Aufgaben einer Lehrkraft messen. Auf Grund eines höchst antiquierten Hierarchieverständnisses wird oft unterschlagen, dass Referendare mit allen Konsequenzen bereits als voll verantwortliche Lehrkräfte handeln, daher müssen im Sinne eines kollegialen, partnerschaftlichen Verhältnisses „die Prinzipien des beruflichen Lernens von Erwachsenen ... stärker zum Zuge kommen.“ (a.a.O., S. 42) Hierzu benötigt es Zeit und Geduld; weder dürfen die Anfänger mit bedarfsdeckenden Unterrichtsstunden erdrückt, noch als Notnagel einer verfehlten Personal- oder Einstellungspolitik (siehe die sog. „Unterrichtsgarantie“ in Hessen) missbraucht werden.
Weiter beziehen sich konstruktive Überlegungen auf die heikle Frage der „Qualifizierung, Rekrutierung und Weiterbildung des Ausbildungspersonals, (die) dringend verbessert werden [sollte]“. (ebd.) Auch hier würde eine personelle Dynamisierung analog der generell zu fordernden zeitlichen Befristung von Lehraufträgen und fachdidaktischen Stellen im Hochschulbereich vermutlich positive Effekte nach sich ziehen. Das könnte bedeuten, dass engagierte Mitarbeiter bei einer entsprechenden Bestätigung in ihrer Funktion und einer Transparenz ihrer fachlichen Tätigkeiten (Leitung von Fortbildung, Schulentwicklung, Praktika/Projekte, Kompaktseminare, Veröffentlichungen, Vorträge, Kommissions- und Gremienarbeit etc.) die befristete Funktion am Seminar fortsetzen bzw. dass überforderte Ausbilder ausscheiden. Maßstab dafür ist das qualifizierte Feedback einer inneren und äußeren Evaluation, die sowohl von den Betroffenen (Berichtspflicht) als auch den „Abnehmern“ der Betreuung in Zusammenarbeit mit einer externen Clearing-Stelle zu verantworten ist.
7. Zentren für Lehrerbildung als Kooperationsinstanzen
Die inzwischen in vielen Bundesländern durch Änderung der Hochschulrahmengesetze etablierten „Zentren für Lehrerbildung“ und die dort gesammelten verschiedenartigen Erfahrungen sind ein erster Schritt in die richtige Richtung, um durch eine fachbereichs- und institutionsübergreifende Infrastruktur Einfluss auf die „immer noch getrennten Welten“ (Terhart 2000) des Ausbildungsprozesses zu nehmen. Die Zentren müssen sich angesichts einer zweifellos vertrackten Lage und Vielzahl von Streitfragen zu durchsetzungsfähigen Einheiten entwickeln, die im Organisationsgefüge von Hochschulen, Seminaren und Schulaufsicht nicht umgangen werden dürfen. Um es zu wiederholen: Lehrerbildung ist eine genuin gemeinschaftliche Aufgabe, sie soll von einem chaotischen System in ein überschaubares transformiert werden. Einzeln erworbene Module sollen „kompatibel“ sein.
Die Entscheidung, Zentren zu etablieren, verweist auf einen pragmatischen Weg: Ihre rechtswirksamen Beschlüsse, ausgehandelten Standards, Auflagen und Empfehlungen sind bindend für Fachbereiche und Kooperationspartner. „Wenn das politisch gewollt ist, was der Lehrerausbildung zweifelsohne nützen kann, dann sollte allerdings auch über eine attraktive Ausstattung der Zentren nachgedacht werden. ... Verwiesen werden sollte in diesem Zusammenhang auf die Überlegungen, Entscheidungsstrukturen zu schaffen, die eine Beteiligung und eine geteilte Verantwortung der Trägerinstitutionen (Universitäten, Seminare, Schulen, Fortbildung) für gemeinsam durchgeführte Ausbildungsabschnitte ... ermöglichen.“ (Wildt 1995; S. 81) Ermutigend sind publizierte Erfahrungen, in denen von eigenständig formulierten Kooperationsaufgaben und gemeinsam getragenen Projekten zur Etablierung einer veränderten Schul- und Lernkultur berichtet wird (vgl. www.uni-kassel.de/zlb). Das alles setzt freilich Kapazitäten und Ressourcen unterschiedlichster Art voraus, die durch eindeutige bildungspolitische Weichenstellungen, insbesondere durch Personal- und Mittelzuweisungen, stärker als bisher flankiert werden müssen. Diese Entscheidungen sollten sich deutlich von Wahlkampfversprechen, vollmundigen Absichtsbekundungen oder trickreichen Nullsummenspielen unterscheiden. Die seriöse Wahrnehmung bzw. Erfüllung dieser Aufgaben darf nicht selektiv unter dem Aspekt kurzfristiger Erfolgsaussichten oder ihrer Finanzen betrachtet werden bzw. vom Idealismus einzelner Personen oder innovationsfreudiger Institutionen abhängen.
Summa summarum: Reformierte Strukturen und im Konsens erzielte Rahmenvereinbarungen zwischen den beteiligten Institutionen tragen dazu bei „eine gewisse Struktur und Kohärenz in das fragmentierte, chaotische System des gegenwärtig wohl eher zufälligen beruflichen Lernens von Lehrern zu bringen.“ (Terhart 2002, S. 75) In Zukunft anzustrebende „Standards für den Lehrerberuf“ liefern hinreichenden Diskussionsstoff für die nächsten Schritte gemeinsamer Zusammenarbeit. Wundermittel sind sie mit Sicherheit nicht. Obwohl zahlreiche Dilemmata existieren und noch manche Barriere überwunden werden muss, geben die entsprechenden Anstrengungen von Pädagogik und Bildungsadministration Anlass zu der Hoffnung, dass die vorgeschlagenen Standards für das Unterrichten einen wichtigen Beitrag für die Erziehung der Erzieher leisten – für solche Lehrkräfte, die auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts besser als bisher vorbereitet sind.
8. Der Eiertanz als Metapher
Zitierte Quellen
Wo im Folgenden aus Gründen einer kommunikativen Sprache lediglich die männliche Form genutzt wird, ist die weibliche selbstredend eingeschlossen.
Arnold, R./Schüßler, I.: Wandel der Lernkulturen. Ideen und Bausteine für ein lebendiges Lernen. Darmstadt 1998
BDK: Kunst und ästhetische Bildung in der Schule der Zukunft. In: BDK-Mitteilungen, Heft 2/1995 und BDK: Die Welt der Bilder – ein konstitutiver Teil der Allgemeinbildung. BDK-Materialien Bd. 7, Hannover 2001
Benner, D.: Die Struktur der Allgemeinbildung im Kerncurriculum moderner Bildungssysteme. In: Zeitschrift für Pädagogik, Heft 1/2002, S. 68-90
Bessoth,R./Weibel, W.: Unterrichtsqualität an Schweizer Schulen. Hilfen zur Steigerung und Sicherung der pädagogischen Wirksamkeit. Zug 2000
Bohnsack, F.: Widerstand von Lehrern gegen Innovationen in der Schule. In: Die deutsche Schule, 87.Jg., 8/1995, S. 21-37
Breughel-Breughel. Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen Museums Wien. Lingen 1997
Dalin, P.: Schule auf dem Weg in das 21. Jahrhundert. Neuwied 1997
Eisner, E.W.: Die Mythologie der Kunsterziehung. Zeitschrift f. Kunstpädagogik, 1/1977, S. 1-6
Giesecke, H. Wozu ist die Schule da? In: Fauser, P. (Hrsg.): Wozu die Schule da ist. Eine Streitschrift. Seelze 1996
Hänsel, D./Huber, L. (Hrsg.) Lehrerbildung neu denken und gestalten. Weinheim/Basel 1996
Josczok, D.: Bildung – keim Megathema. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 36/2001, S. 33ff.
Jung, M.: Wie wirksam, wie unwirksam ist unsere Lehrerbildung? In: Seminar 1/1997, S. 7-30
Herrmann, U.: Lehrern fehlt der Leistungsmaßstab. In: DIE ZEIT, Nr. 48 v. 21.11.2002 (Interview); vgl. vom gleichen Autor: Wie lernen Lehrer ihren Beruf. Weinheim/Basel 2002
Horster, L./Rolff, H.-G.: Unterrichtsentwicklung. Weinheim 2001
Huwendiek, V.: Probleme und Perspektiven der gymnasialen Lehrerausbildung. In: Seminar 3/1999, S. 39-51
Kästner, M.: Wer soll mit welcher Qualifikation Professor für Bildende Kunst und ihre Didaktik werden? In: BDK-Mitteilungen 2/2001, S. 37/38
Kemper, H.: Kooperation der ersten, zweiten und dritten Phase der Lehrerbildung. In: Seminar 2/1996, S. 37-50
Kirschenmann, Johannes: Kunst braucht Gunst. In: Süddeutsche Zeitung vom 20./21.04. 2002
Kommission zur Neuordnung der Lehrerausbildung an Hessischen Hochschulen. Neuordnung der Lehrerausbildung. Opladen 1997 (sog. Bohnsack-Kommission)
Kretzer, H.: Erste und Zweite Phase der Lehrerausbildung in der Wahrnehmung von Studienreferendaren und Lehramtsanwärtern. In: Seminar 1/1997, S. 35ff.
K+U – Sammelband „Theorie“; hrsg von Grünewald, D. (Kunstdidaktischer Diskurs, Texte zur Ästhetischen Erziehung) 1996; darin: Thesen zur Ästhetischen Erziehung, S. 23-26
Messner, R.: Gymnasiale Bildung und Wissenschaft. In: Messner, R. et al (Hrsg.): Die Zukunft der gymnasialen Oberstufe. Beiträge zu ihrer Weiterentwicklung. Weinheim u. Basel 1998, S. 59-100
Neuweg, G.H.: Lehrerhandeln und Lehrerbildung im Lichte des Konzepts des impliziten Wissens. In: Zeitschrift für Pädagogik, Heft 1/2002, S. 10-29
Oelkers, J.: Die Rolle der Erziehungswissenschaft in der Lehrerbildung. In: Hänsel/Huber, a.a.O., S. 39ff.
Oelkers, J.: Schulentwicklung und Effizienz. In:Pädagogisches Handeln, 1. Jg. 1997, Heft 1, S. 23-37
Oelkers, J.: Lehrerbildung aus der Sicht der Erziehungswissenschaft. In: Seminar 3/1999, S. 15-25
Oser,F./Oelkers, J. (Hrsg.): Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme. Von der Allrounderbildung zur Ausbildung professioneller Standards. Chur/Zürich 2001
Otto, G.: Theorie für pädagogische Praxis. In: K+U Sammelband „Theorie“, a.a.O., S. 85-88
Otto, G.: Lehren und Lernen zwischen Didaktik und Ästhetik. Bd. 1 Ästhetische Erfahrung und Lernen. Seelze 1998
Rolff, H.-G.:: Was soll die Schule leisten? In: Erziehung & Wissenschaft, Heft 2/1992, S. 6f.
Rolff, H.-G./Fischer, D.: Autonomie, Qualität von Schulen und staatliche Steuerung. In: Zeitschrift für Pädagogik 4/1997, S. 537-549
Rolff, H.-G.: Pädagogisches Qualitätsmanagement: Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung vor neuen Herausforderungen. 1998 (IFS-Manuskript)
Rolff, H.-G.: Die Stunde der Schulentwicklung. In: Frankfurter Rundschau vom 12.12.2002
Rittelmeyer, Chr.: Gute und schlechte Lehrerinnen und Lehrer. Erfahrungen von Studierenden und Vorschläge zur Weiterbildung. In: Die Deutsche Schule, 92. Jahrg. 2/2000, S. 158-167
Röhrich, L.: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg 1977
Schütz, H.G.: Die Kunstpädagogik öffnen. Hohengehren 1998
Selle, G.: Über das gestörte Verhältnis der Kunstpädagogik zur aktuellen Kunst. Hannover 1990
Stehr, W.: Wider die methodische Monokultur. Werkstattunterricht aus bildungsplanerischer Perspektive. In: Kirchner, C. und Peez, G. (Hrsg.): Werkstatt: Kunst. Anregungen und Erfahrungen zu ästhetischen Lernprozessen im Werkstattunterricht. Hannover 2001
Struck, P.: Erziehung von gestern Schüler von heute Schule von morgen. München 1997
Terhart, E.: Lehrerausbildung: Unangenehme Wahrheiten. In: Pädagogik 9/1992, S. 32ff.
Terhart, E. (Hg.): Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland. Abschlußbericht der von der KMK eingesetzten Kommission. Weinheim 2000
Terhart, E.: Nach PISA: Bildungsqualität entwickeln. Hamburg 2002
Terhart, E.: Standards für die Lehrerbildung. Eine Expertise für die KMK. Script Univ. Münster 2002
Ulich, K.: Lehrer/innen-Ausbildung im Urteil der Betroffenen. In: Die deutsche Schule, 1/1996, S. 81-98
Weiler, H.N.: Die selbstzufriedene Disziplin. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 232 v. 08.10.2002, S. 17
Wildt, J.: Reflexive Lernprozesse. Zur Verbindung von wissenschaftlichem Wissen und Handlungswissen in einer integrierten Lehrerbildung. In: Hänsel/Huber, a.a.O., S. 91-107
Wissenschaftsrat: Noten ohne Wert (Autor: M. Spiewak). In: DIE ZEIT, Nr. 9/2003
Wollring, B. et al: Empfehlungen zur Aktualisierung der Lehrerbildung in Hessen. Bericht der Expertengruppe Lehrerbildung, eingesetzt durch das Hess. Kultusministerium u. Ministerium f. Wissenschaft u. Kunst. Wiesbaden 2003; siehe http://www.kultusministerium.hessen.de
© Werner Stehr, alle Rechte vorbehalten - Version 20-04-03
Der Beitrag findet sich in gekürzter Form in den BDK-Mitteilungen 2003

Der Tanz ums Ei.
Oder: Schulentwicklung und Lehrerbildung
im Schatten des schiefen Turmes