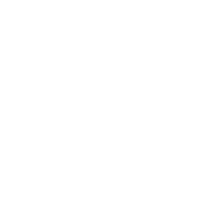Matthew Ngui zum Kulturthema Essen:
»You can order and eat delicious Poh-piah«
»Der Vorzug der dX ist die Kompromißlosigkeit ihrer Leiterin und das straffe und klare Konzept, das puristisch und höchst anspruchsvoll ist. Frau David [...][will]den Kunstbetrieb [...] reformieren [...] und [hat] dazu nach den vielen üppigen und populistischen Kunstfestivals, nach Orgien von Malerei eine strenge Diät verordnet.«
(Eduard Beaucamp in: DIE WOCHE v. 4.7.1997, S. 2).
Die Äußerung läßt eine Affinität zum gewählten Werk erkennen, obwohl der kulinarische Beitrag des Singapurer Künstlers Matthew Ngui nicht unbedingt einer »strengen Diät« im wörtlichen Sinne genügt. Mit »extremer Präzision«, äußerte Catherine David zu Ngui, zeigt er in seiner Arbeit einen Weg auf, der aufgrund seines experimentellen Charakters und der intellektuellen Dichte den Enttäuschungen einer leblos gewordenen, vielfach nur noch sich selbst reproduzierenden Kunst entgegenzuarbeiten vermag. Nicht nur, weil ›Poh-piah‹, die fernöstlichen Crêpes-ähnlichen und mit einer leckeren Gemüsefüllung versehene Reispfannkuchen beim Riechen und Schmecken die Sinne ansprechen, viel bedeutsamer erscheint; inwiefern die mehrschichtige innere Logik des Beitrags im Betrachtungsprozeß Fragen zu provozieren imstande ist, die eigene Wahrnehmungen und Denkbewegungen in Gang setzen. Das Werk enthält durch seine vielfältigen sinnlichen Angebote und die dabei zu entdeckenden Bedeutungsringe weit mehr als eine bloße Animation des Publikums.
Neben einer stattlichen Anzahl weiterer junger Künstler der dX zählt Ngui nicht aus Zufall international zu den Senkrechtstartern. Eine Variante seines Beitrags existierte bereits in Form einer ähnlichen Arbeit (Cooking fried rice) anläßlich der Biennale São Paulo (1996). Wer also immer behauptete, innerhalb der Ausstellung fände sich absolut nichts Bemerkenswertes oder alles sei kalter Kaffee, der liegt so daneben wie die verknöcherte Frankfurter Rundschau oder der in die Jahre gekommene Bazon. Mag es gar sein, daß einigen der Schwarzmaler (schlägt der Thesaurus von word für ›Pessimisten‹ vor) im Zeitalter von BSE und den Wildecker Herzbuben jene notwendige Imaginationskraft, »ohne die keine Rezeption aufgeht« (Brock), abhanden kam? Also, was nun bitteschön? Kurz: Was mich ausschließlich an der Diskussion um das Konzept der dX, oder besser, an einigen ihrer außergewöhnlichen Exponate interessiert, ist weniger der Habitus der Kuratorin oder das Tamtam drumherum, sondern vielmehr die sichtbare, ablesbare Kraft einiger Künstler in einer Zeit der gesellschaftlichen Schwäche. Es geht um künstlerische Formen und Praxen, die in ihrer Resistenz gegenüber allen möglichen Korrumpierungsversuchen bestechen. Es geht meinetwegen auch um »Kunst als eine Form visueller Forschung«, wie es Jean-Christophe Ammann formulierte, die Möglichkeitsräume zu entwerfen imstande ist. Das ist es, was zu Matthew Nguis Konzept, das er, zum Teil singend, im Rahmen von »100 Tage -100 Gäste« anschaulich vortrug, dazugehört wie die Sojasprossen zur Frühlingsrolle.
»Wenn Sie mit dieser Installation kommunizieren wollen, sprechen Sie bitte deutlich in das Rohr. Danke. Wenn Sie köstliche Poh-piah bestellen und essen wollen, sprechen Sie bitte deutlich in das Rohr. Danke.« (Bildschirmtext des Künstlers)
Wer die lichte Fabrikarchitektur des Südflügels des Kulturbahnhofes betrat, sah sich in den großzügigen Räumen mit dem Werk des jungen, verschmitzten Künstlers Matthew Ngui (Jahrgang 1962) konfrontiert. Wie bei anderen Exponaten der dX kam man auch hier rasch zur Sache, bekanntermaßen verabscheute die Kustodin jedes Imponiergehabe, was Werke und Vermittlungsprozeß gleichermaßen betraf.
Es handelte sich bei diesem Originalbeitrag Matthew Nguis für die documenta um eine experimentelle Synthese aus Installation und Performance, die der Künstler mit »›You can order and eat delicious poh-piah‹, amongst other things« betitelte. Irgendwo ist Nguis Beitrag, den er aufgrund seiner Prozesshaftigkeit und Offenheit selbst als »selfgrowing Installation« bezeichnete, zwischen Ready-made-Verfahren, raumsprengender Aktionskunst oder Performance angesiedelt, wobei die entstehenden bzw. übrigbleibenden Kunsterzeugnisse mit weiteren künstlerischen Verfahren korrespondieren. Die Relikte erinnern etwa an Daniel Spoerris »Fallenbilder« aus den sechziger Jahren, kategoriale Zurdnungen bleiben jedoch verstellt.. Zur ›Offenheit‹ des Werkes gehörte auch jener halbierte Stuhl, der, wollte man ihn vollständig sehen, vom Standpunkt des Betrachters aus optisch entsprechend austariert werden mußte.
Der schon im Titel angelegte Akzent des Gegenüber impliziert die aktive Teilhabe der Besucher; das Werk lebt unverzichtbar von der Präsenz der Akteure. Ohne Mitmachen - worauf ich noch zurückkomme - reduziert sich das Ganze auf einen eher fragmentarischen Charakter. Zum Beispiel gaben bei Abwesenheit des Künstlers nur stumme Requisiten in einer Art Spurensicherung Kunde davon, was zuvor gewesen war. Was sich übrigens als großes Manko herausstellte, - Ngui war etwa zehn Tage zu Beginn der Ausstellung und dann nur noch ein paar Tage im September präsent. In der Zwischenzeit waren lediglich die fest installierten Elemente bzw. die angesammelten Überbleibsel - in Form leergegessener Pappschälchen zu besichtigen.
Das eigenartige kulinarische Angebot bestand auf den ersten Blick nur aus sorgfältig verlegten grauen Kanalrohren bzw. verzinktem Lüftungsrohren, die fachmännisch-winklig aufgehängt oder die Wände durchdringend sich vom Erdgeschoß bis in das dritte Stockwerk schlängelten. Jeder Handwerker hätte der pingeligen Verarbeitung wegen seine Freude daran, so vermute ich mal. Darüber hinaus - und das wäre der zweite Blick - ließen die scheinbar planlos applizierten Röhren und Bögen zugleich ein sichtliches »Vergnügen am künstlerischen Raum« erkennen, wie es Dirk Schwarze in einem HNA-Beitrag formulierte. Dies alles in keiner linearen Logik, etwa den kürzesten Weg suchend, einem gleich ersichtlichen System folgend oder diszipliniert im Rohrverbrauch, sondern umständlich, schleifenhaft und verfänglich. Eine ästhetische Spannung ließ sich hier kaum auszumachen, eher ein Unbehagen aufgrund der Undurchsichtigkeit, weil der Betrachter natürlich gern wissen möchte, was es mit dem fortlaufenden Röhrensystem im nächstfolgenden Raum oder Treppenhaus auf sich hat. Sicherlich ist auch ein Erwartungsgefühl im leibhaftigen Sinne nicht ganz abwegig - denn aufgrund des Nahrungsversprechens im Titel läßt sich eine Verwandtschaft zum Pawlowschen Reflex herstellen. Es sprach sich rasch herum, daß Matthew Ngui als eine Art Profikoch es locker fertig brachte, so zehn bis zwanzig der fernöstlichen Snacks hintereinander zu servieren.
Wer sich auf seine Arbeit im Eingangsbereich einließ, wurde allerdings fast immer irritiert durch die vielen herumwuselnden Besucher, die den Blick nicht so recht freigaben auf die einzelnen Bestandteile der Installation. Auch schien die Unruhe am Entree sich durch die aufdringlichen Plakate von Rem Kolhaas noch optisch zu verstärken. Doch steckte hier vielleicht eine Inszenierungsidee dahinter? Gehörten die absichtlich herbeigeführte Ton- und Sehstörungen etwa zum Programm des Werkes?
Beim Weiterlenken des Interesses - zweckmäßigerweise brauchte man dabei nur dem Verlauf der Leitungen verfolgen - kam man rasch zu den beiden kleinen Häuschen. In ihnen befanden sich jeweils neben einem Stuhl ein paar rätselhafte Kohlezeichnungen, die sich, wie sich später herausstellte, als karikaturhafte Selbstbildnisse des Künstlers entpuppten. Um die Entdeckungen abzurunden: in dem einen Häuschen befand sich ein gewöhnlicher switched on Computermonitor und in dem anderen lediglich eine Tastatur. Die schon erwähnten ominösen Kunststoffrohre endeten jeweils in Kopfhöhe.
»Die Massen nehmen an Ereignissen teil, von denen sie nichts verstehen. Das macht aber nichts.« (Michael Rutschky in nbk aktuell, Heft 3/1997, S.15)
Rutschkys Verblödungstheorie scheint am Beispiel Matthew Nguis Beitrag nicht aufzugehen, denn wer vermag schon einzuschätzen, was jemand wovon versteht? Zumindest die bildungsbürgerlich-betuchte Klientel der Ausstellung (vgl. die Untersuchungen von Michael Hellstern) paralysierten die Untertöne der Kritik, die sich ihrerseits damit schlicht der Verlogenheit verdächtigt. Neugier gegenüber dem Werk wird durch Aktivitätsformen bestätigt, es geht auch um Offenheit, die dem künstlerischen Kalkül entgegengebracht wird. Und Matthew Nguis Installation war ständig umlagert.
Die Besucher zierten sich, reagierten belustigt, auch verunsichert, fühlten sich wie ertappt angesichts der sich auf dem Monitor auftürmenden Botschaften. Nur wenige überwanden sich, um Kontakt aufzunehmen. »Hello, how are you?«, »Are you really there?«, »I want to eat your meal«. So oder ähnlich begann der Dialog, und hier lag nun der Haken, denn der kulinarische Genuß war noch fern, und der Gast konnte lediglich durch ein Rohr antworten, aus dem kein Piep zurückkam. Kennen wir solch eine ähnliche Situation aus alten U-Boot- Filmen? Wegen des Lärmes erfolgt dort die Kommunikation über ein hermetisches Röhrensystem. Das heißt, die Bedingungen, um in den Genuß einer vom Künstler zubereiteten ›Poh-piah‹ zu gelangen, sind, rein technisch betrachtet, ausgesprochen umständlich. Publikum und Künstler lassen sich auf ein Spiel ein.
Dann ging es erst richtig los. Im zweiten Häuschen lauschte Ngui den eintreffenden Antworten, hämmerte sporadisch in die Tasten und textete stakkatoartig auf Englisch oder Chinesisch, was ihm scheinbar gerade so einfiel: »Sind sie heute auch naß geworden?«, »Bitte sprechen sie lauter!«, »Welches ist ihr Lieblingstier?«, »Was wissen sie über Singapur?«, »Essen sie gern im Restaurant?« et cetera. Die Fragen, die sich inclusive vieler Tippfehler am Bildschirm addierten, erschienen beliebig, austauschbar, waren assoziativ oder diszipliniert, - ganz nach Interesse und Laune des Künstlers. Es ging im umständlichen Dialog aber um mehr, und jeder hatte dabei seinen mühseligen Part zu spielen. Ngiu streifte gezielt ›Geschmacksfragen‹ in ihrer semantischen Mehrdeutigkeit, er jonglierte mit kulturellen Differenzerfahrungen oder insistierte auf Wissenslücken des Partners (»Was schätzen sie, wie viele Einwohner Singapur hat?«). Zweifellos war der Teilnehmer hierbei der unberechenbaren Regie am anderen Ende der Leitung ziemlich ausgeliefert. Der Künstler fragte in einer im Sinne des Wortes ›beschränkten‹ Interaktion, die gelegentlich Züge des Absurden in sich trug.
Oben hatte ich bereits die beachtlichen Distanzen im Gebäude erwähnt, denn die Installation und die drei primären Aktionsorte erstreckten sich über mehrere Stockwerke. Die beiden beschriebenen Equipments befanden sich neben der Ansammlung besagter Pappschüsseln und weiteren Ngui-Objekten im Eingangsbereich. Die Küche für die Zubereitung und Übergabe der Poh-piah lag hingegen im Dachgeschoß. Viele Zuschauer pendelten deshalb zwischen den unterschiedlichen Orten der Performance hin und her.
„Kunst hervorzubringen, die den Nerv der Zeitgenossen trifft, ist ein schwieriges Geschäft.“ (Wieland Schmied in: art spezial 6/97, S. 42)
Nach Luhmann ist es ein Irrtum, daß Kommunikation im Verstehen besteht, daß man irgend etwas anschließen kann. Was man tatsächlich anschließen kann, ist die freie Entscheidung des Publikums. Leser machen aus Texten, was sie wollen, Wähler machen was sie wollen. Jedem steht es frei, das Interaktionsangebot anzunehmen oder abzubrechen. Matthew Ngui versicherte, daß jemand, der in seine Performance einsteigt, zumeist bis zum Genuß des kleinen Gerichts durchhält. Zeitgenössische Kunst erzieht mit ungewöhnlichen Mitteln auch zu einer neuen Wahrnehmung, deshalb finden die Menschen sie so interessant; sie trainiert uns für das Ästhetische.
Je nach Länge und Verlauf des umständlichen Dialogs zwischen mündlicher Rohrpost und Computerantwort verlagerte der Künstler anschließend seinen Aktionsort flinken Schrittes in den Küchenbereich, dessen Ausstattung spärlich und funktional war. Bunte Plastikschüsseln standen scheinbar willkürlich aufgereiht auf einer Konsole, es bleibt unentschieden, ob sie als hinzuaddierte Ready-mades gelten, möglicherweise ein dem Alltag entlehntes Farbspiel darstellen oder direkt etwas mit der Installation zu tun haben könnten. Nach Nguis Auffassung sollte das Publikum selbst entscheiden, - er sieht seine Arbeit weder als spektakulär noch als etwas besonderes an.
Streng, wie nach einem Drehbuch, lief ein unbedeutendes Ritual ab, in dem der Künstler konzentriert und stumm die Poh-piah zubereitete - manchmal variiert nach den Wünschen des Teilnehmers. Kunstritual oder imitiertes alltägliches Handeln?
Wesen und Kern der Arbeiten Matthew Ngius sind Anspielungen auf jene Grenzbereiche, wie sie zwischen banalem Alltagshandeln und Kunstansprüchen angesiedelt sind. Dabei wird das eine wegen seiner Allgegenwärtigkeit häufig übersehen, das andere, als Versatzstück des Bedeutungsvollen oder Außergewöhnlichen, droht darin unterzugehen. Alltag funktioniert überall nach Traditionen, ungeschriebenen Regeln, Agreements - oder auch Küchenrezepten, wie in diesem Falle. Anhand welcher archaischen Tätigkeit könnte man das Wechselspiel zwischen existentiell Notwendigem und kultureller Feinabstimmung plausibler aufzeigen als am Beispiel des Essens?
Hunger und Sättigung sind uns als universelle Kulturthemen durch Geschichte und Erinnerung ebenso präsent wie durch medial vermittelte Botschaften. Erfahrungen, die jedermann mitbringt, die von der Kenntnis eines industriell produzierten Fast food bis zur immensen Prasserei in den sogenannten Kulturnationen reichen. Aufgrund eigener biografischer Spuren - mit einem erst in den sechziger Jahren aus dem Kolonialismus entlassenen und sich steil entwickelnden Inselstaates - geht es dem Künstler besonders auch um die mit ästhetischen Mitteln betriebene Suche nach einer Identität inmitten verschiedener Welten. Bei der Erforschung dieser Kontexte kann sich Matthew Ngui auf keinen festen Standpunkt einlassen; etwas ähnliches mutete er dem Publikum zu. Ich beobachtete ihn, wie er sein Gericht fertigstellte und es mit einer höflichen Verbeugung der Gesprächspartnerin überreichte. Unerwartet klatschten die Herumstehenden Beifall, den Ngui nicht mehr bis zum Schluß mitbekam. Denn er war treppabwärts schon wieder unterwegs zum unkalkulierbaren Dialog.
© Werner Stehr
erschienen in: Bernhard Balkenhol/Heiner Georgsdorf (Hrsg.): x mal documenta X. Über Kunst und Künstler der Gegenwart. Ein Nachlesebuch zur 10. documenta (ISBN 3-88122-963-9; Veröffentlichung der Kunsthochschule in der Universität Gesamthochschule Kassel), Kassel 1998, S. 126 - 132