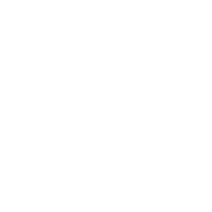Gábor Ösz: »Travelling Landscapes« –
flüchtige Welt im Zugfenster
Abbildung unter:
http://www.gaborosz.com/travelling_doc.html
Vom ungarischen Foto- und Konzeptkünstler Gábor Ösz (Jahrg. 1962), international gefeiert und seit einigen Jahren in Amsterdam lebend, bekommen wir durch die visuellen Fakten seiner Arbeit einen festen Standpunkt zugewiesen. Und zwar im doppeldeutigen Sinne. Folgen wir zunächst den physikalischen Reflexionsgesetzen (die Sache mit dem Einfallswinkel...), dann spiegelt sich vorn in der linken Bildhälfte in einem Waggonfenster – ungefähr im 45 Grad-Winkel zur Position des Betrachters – die etwas trostlos wirkende Ansicht rückwärtig gelegener Bahnanlagen. Neben der – ebenfalls reflektierten – Eisenkonstruktion einer Überdachung ist ferner ein ziegelrotes Bahnhofsgebäude zu sehen. Wir kennen solche öffentlichen Orte, austauschbar, anonym, unwirtlich. Zu den nüchternen Fakten zählen die anscheinende Menschenleere, feine Details der Komposition oder die sensible Farbgebung ebenso wie die präzise geografische Bestimmung, die sich hier durch den Titel ergibt: Demzufolge befindet sich der tiefblaue Personenzug, der unterwegs nach Italien ist, im Zwischenstopp in Den-Bosch in den Niederlanden. Und nur wenn man sehr genau hinschaut, sind auf dem entvölkerten Trottoir, im Augpunkt unseres zentralperspektivisch gebändigten Blicks, in der Ferne ein paar winzige Figuren zu entdecken.
Doch die Frage der Auslegung darf sich nicht lediglich auf die Requisiten der Aufnahme oder die Rekonstruktion der Standpunkte von Fotograf oder Betrachter beschränken. Das alles ist zwar hilfreich zur Analyse der Fotoarbeit, würde jedoch einem reduktionistischen Verständnis folgen. Zudem bedient sich Ösz einer antiquierten Lochkamera, – auch dies alles andere als nur ein Spleen. Denn die gezielt angelegte „Doppeldeutigkeit“ solch konzeptioneller Kunst, die ja gerade dadurch ihren besonderen Reiz gewinnt, wäre außer acht gelassen. „Avancierte Kunst ist theorieimprägniert“ hatte der Kunstphilosoph Harry Lehmann jüngst erneut behauptet. Und sie sei durch ihren impliziten Anspruch, kraft ihrer Praktiken zu bisher unbekannten ästhetischen Erfahrungen zu gelangen, zugleich „extrem kommentarbedürftig“ (Lehmann 2012, S. 17). Dem ist beizupflichten, denn Ansatzpunkte zur Erforschung verschlüsselter Standpunkte bieten sich viele.
Gábor Ösz verwickelt uns nämlich mit seiner Fotoarbeit in eine komplizierte Abbild-Diskussion, was durch den oberflächlichen ästhetischen Reiz einzelner Bildelemente leicht übersehen wird. Klar, hier wurde an einem trüben Tag lediglich qua Schnappschuss ein banaler Reisezug festgehalten. Also ein „Augenblick“ im Verharren eines sich ständig bewegenden Motivs, doch dessen nüchterner Wirklichkeitsanspruch hier zusätzlich durch elegante Gestaltungselemente, wie die pfeilartigen Diagonalen, den dynamischen Schwung der Stahlträger oder die feine gelbe Linie im tiefen Blau, die sich zudem in einem undefinierbaren Transportgerät in milder Spiegelung wiederholt, ästhetisch aufgeladen wird. In formal-gestalterischer Hinsicht handelt es sich bei der Aufnahme um ein Sahnestück. Doch was erzählt der „fest-gehaltene“ Waggon darüber hinaus?
Im Zugfenster spiegelt sich die Welt.
Sicher ist es ein anregender Gedanke, sich die Waggonfenster als Teil eines Innenraumes vorzustellen, als Einladung zum Betrachten der vorbeiziehenden, stets im Fensterausschnitt nur begrenzt sichtbaren Landschaft. Ösz kehrt diese Logik um, denn über die gesamte Fahrtstrecke hinweg spiegeln sich in den Fensterscheiben – von außen – ebenso die Versatzstücke der Welt. Wie gesagt, die hier per Foto eingefrorene Spieglung kann das nur gekürzt wiedergeben. Sie wirkt raumbildend, indem sie die Bahnhofszene über den Ausschnitt hinweg motivisch erweitert. So kühn von unserem hinzuaddierten Spiegelbild im Bild obendrein behauptet wird, es handele sich um „reisende Landschaften“, denn Ösz nennt seine Serie „Travelling Landscapes“, so fragil bleibt der unleugbare Tatbestand eines zwar blitzschnell erkannten, doch nur flüchtigen Eindrucks. Weil er mit der trügerischen Illusion verwandt ist, galten solche Spiegelbilder lange Zeit als magisches Hexenwerk. Heute sind wir weit davon entfernt, viele Künstler und mit ihr die Kunsttheorien haben sich über Jahrhunderte hinweg ausführlich mit diesem immateriellen Phänomen beschäftigt.
Unser mittlerweile nicht mehr so simples Bahnhofsbild mit den banalen Waggons und ihren – jetzt von außen erblickten – „reizvollen“ Fenstern, verweist auf grundlegende Fragestellungen jeder ikonografischen Darstellung. Ihre an der Wirklichkeit gemessene Ähnlichkeit korrespondiert in formaler Hinsicht mit einer gerahmten Bildtafel, die als solche ihr – tatsächliches oder erfundenes – Vor-Bild nur imitiert und immer eine ausgewählte und reduzierte Sicht bedeutet. Das Realität suggerierende Bild ist insofern mit einem offenen Fenster vergleichbar, das ebenfalls nur einen Teil des Ganzen preisgeben kann. Ausgehend von Platons Betrachtungen hatte dies schon 1435 der Florentiner Architekt und Universalgelehrte Leon Battista Alberti (1404-1472)in seiner berühmten Abhandlung „De Pictura“ (Über die Malkunst) als fundamentale Erkenntnis niedergeschrieben, die über Jahrhunderte hinweg mit ihren Begründungen die einzigartige Leistungsfähigkeit des Bildes prägten.
Als hervorgehobenes Element einer Folge fügt sich das Foto Gábor Öszs schlüssig in sein übriges Gesamtwerk, das sich der intensiven Erforschung des Sichtbar-Machens widmet. Die leidenschaftliche Auseinandersetzung mit bildwissenschaftlichen Denkfiguren, Paradoxien oder Methoden bildet dabei meist den Kern seiner Ideen. Nicht zuletzt durch seine internationale Reputation wurde ihm im Sommer 2013 eine umfassende Einzelausstellung im Budapester Ludwig Museum für zeitgenössische Kunst gewidmet.
Literatur
Eco, Umberto: Über Spiegel und andere Phänomene. München 1999 (dtv)
Lehmann, Harry (Hg.) Autonome Kunstkritik. Berlin 2012
Ösz, Gábor: Three by Three. MER Paper Kunsthalle, (Gent) 2013-12-16
© Werner Stehr
Gábor Ösz: »Travelling Landscapes« – flüchtige Welt im Zugfenster.
In: Zeitschrift KUNST 5 –10, Heft 34/2014 (Friedrich Verlag), S. 44 ff.