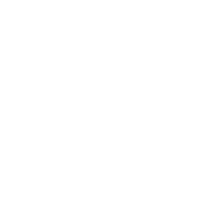94. Tisch-Kultur(en) im Wandel. Essen als symbolisches Verhalten früher und heute. (Gemeinsam mit Kirschenmann, Johannes). In: KUNST+UNTERRICHT, Heft 403/404 I 2016, S. 34 - 48
JOHANNES KIRSCHENMANN & WERNER STEHR
Tisch-Kultur(en) im Wandel. Essen als symbolisches Verhalten früher und heute.

Was gegessen wird und vor allem, wie es gegessen wird, welche Raritäten oder Alltäglichkeiten auf den Tisch kommen und welch spezifische Kennerschaft gegenüberden Speisen und ihrem Verzehr vonnöten sind – all dies weist das Essen und die Tischsitten als demonstratives, kulturell codiertes und damit weit über die bloße Nahrungsaufnahme hinausgehendes symbolisches Verhalten aus. Innerhalb dieses MATERIAL-Teils bilden ausschnitthafte Antworten auf die Leitfrage nach dem „mobilen Essen“ – abseits vom Tisch und vom herkömmlichen Reglement – einen hoch aktuellen Aspekt aus.
Zum Symbolwert des Essens
Die Abbildung (MATERIAL 1, S. 37) fordert auf, die Bedeutung des raschen Essens im Alltag von Jugendlichen zu erkunden und mit den Inszenierungen in heutigen Zeitschriften auf ihre Symbolsprache hin abzugleichen. Auch eine thematisch verabredete schulische Tischgesellschaft als Inszenierung mit stilisierten Pointierungen kann die Unterrichtspraxis bestimmen. Mit Pantomime oder Performances können ganz unterschiedliche Essszenen aus dem MATERIAL-Teil zugespitzt werden, fotografiert oder gefilmt und dann in einen Vergleich gesetzt werden.
Bürgerliche Etikette und Alltagsleben
Die Geschichte der Tischsitten ist als Zivilisierung der Esslust zu beschreiben. Standen am Anfang die kirchlich verordneten Fastenrituale neben den weltlichen Luxusbeschränkungen – zur Vermeidung wirtschaftlichen Ruins und Sicherung der Versorgung – so ging der Fremdzwang mit Beginn des 16. Jahrhunderts in Verinnerlichung und Selbstkontrolle über (MATERIAL 2 A, S. 38). Eine Diversifizierung der verfügbaren Nahrungsmittel – auch als Folge des zunehmenden Fernhandels – und eine soziale Ausdifferenzierung der Gesellschaft brachten neue Speisen und Tischmanieren. Das Werk von Abraham Bach (MATERIAL 2 B, S. 39) zeigt eine bürgerliche Tischgesellschaft, die zunehmend die Etikette des Adels als Ausdruck ihres ökonomischen Aufstiegs übernimmt, während die Kartoffelesser von van Gogh (MATERIAL 2 C, S. 40) aus gemeinsamer Schüssel die Speisen mit den Händen greifen. Die Separierung beim Essen mittels des eigenen Tellers und des eigenen Bestecks bahnt sich im ausgehenden Mittelalter schon an der feudalen Tafel an. Teller wurden im einfachen Haushalt meist nur zum Festtag herausgeholt, während das gehobene Bürgertum ab dem 18. Jahrhundert auf den eigenen Teller und die – vom spitzen Messer ausdifferenzierte – Gabel Wert legte. Die Tischzucht (1534) von Hans Sachs (http://gutenberg.spiegel.de/buch/hanssachs-gedichte-5222/2) schreibt dem Bürgerstand der Renaissance ein selbst kontrollierendes Verhalten bei Tisch vor; in seiner normativen Anleitung zum Selbstzwang wird deutlich, was der Sozialethnologe Norbert Elias als anwachsende Peinlichkeit und zunehmendes Schamgefühl beobachtet. Das illustrierte Verhalten bei Tisch unterstreicht Abraham Bach in einem dem Bild gleichsam als Bordüre mitgegebenen Text, der im Sinne von Hans Sachs zur Zurückhaltung, zu kleinen Portionen oder Rücksichtnahme gegenüber den Mitspeisenden mahnt. All dies ist in der karikaturhaften Malerei von Harald Duwe http://www.harald-duwe.de/gesellschaft_4.html in den Hintergrund gedrängt zugunsten eines grotesken Sittengemäldes der bundesrepublikanischen Wohlstandsgesellschaft in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts.
Anregungen
Die Bilddokumente und Textquellen geben Anlass zu einem wechselseitigen Abgleich und vertiefender Recherche: Inwieweit folgt die bürgerliche Tischgesellschaft den Instruktionen, wo sind Auffälligkeiten zu entdecken und welcher Verhaltenskodex ist auch aus wirtschaftlichen, religiösen und sozialpsychologischen Beweggründen an den Bildern ablesbar? Was ist heute anders?
Zappelphilipp und die Folgen
Heinrich von Rustiges Gemälde Unterbrochene Mahlzeit (MATERIAL 3 A, S. 41) knüpft an die Tradition biedermeierlicher Genremalerei an. Das Familienbild zeigt eine bühnengerechte Szene bürgerlicher Alltagsbewältigung im 19. Jahrhundert. In der narrativen Struktur kommen die typischen Rollenmuster von Eltern und Kindern angesichts eines Familienkonflikts zum Tragen. Das Bild kann wohl zeitlos als prototypisches Verhalten eines rebellischen Knaben dienen, wie es auch sechs Jahre später der Frankfurter Mediziner Heinrich Hoffmann als inspirierendes Vorbild für seine illustrierte und gereimte Geschichte vom „Zappelphilipp“ (MATERIAL 3 B, S. 42) nutzte. Dem historischen Unruhestifter werden sogar in einer medizinischen Dissertation – publiziert im Jahr 2001 sozusagen in Ferndiagnose – die Symptome des ADHS-Syndroms attestiert. Bewiesen ist hingegen nichts: Nach Auskunft der Bundesärztekammer „leiden“ etwa sieben Prozent aller Kinder und Jugendlichen, die einer Therapie bedürfen, an ADHS.
Anregungen
Der im Bild festgehaltene Fauxpas liefert hinreichende Anlässe zu Erinnerungen, Bildproduktionen und Faktenchecks. Das Drama Zappelphilipp (ARD, als DVD oder KUNST+UNTERRICHT 389 • 390 I 2015 35 bei Youtube verfügbar) zeigt eine Lehrerin im Kampf um ein Kind mit ADHS und beleuchtet das schwierige System Schule – ein Film ohne pädagogischen Zeigefinger, aber mit vielen wahren Momenten.
Tischmanieren muss man lernen
In den Sammelbildern zum Thema „Tischmanieren“ (MATERIAL 4, S. 43) verbergen sich zumeist von der Familie eingeforderte gesellschaftliche Übereinkünfte – auch die Demonstration sozialer Zugehörigkeit, die über gesellige Rituale des Essens gezeigt und verfestigt wurden. Die um die Wende zum 20. Jahrhundert entstandenen Sammelbilder künden vom erwünschten Anstand gegenüber den Erwartungen der älteren Generation. Gemeinhin wird dieser Prozess als Sozialisation bezeichnet. Durch die historische Herausbildung einer „pädagogischen Kindheit“, die gleichlaufend mit ihrer Entstehung einen Kanon an konkreten Verhaltensregeln bei Tisch klar formulierte, wurde die Absicht deutlich, den archaischen und noch unbeeinflussten Lebenstrieb der Nachkommen zu domestizieren, ihn in gemeinschaftsfähige Bahnen zu lenken.
Anregungen
Abbildungen und Text regen zur Diskussion heutiger und historischer Erziehungspraktiken an. Sie lenken auf das weite Feld aktueller massenmedialer Sozialisationsmedien wie die Soaps im Fernsehen und Internet, wo ein viel breiterer Kodex des Verhaltens – weit über das Essen hinaus – inszeniert wird. Zu diskutieren wäre, welche soziale Regulierungskraft, Zwänge, und Widersprüche heutige Tischsitten transportieren.
Mobilisierung des Essens im Industriezeitalter
Der durch die Industrialisierung ausgelöste Strukturwandel brachte der gestiegenen Zahl der Lohnabhängigen eine wesentliche Umstellung des Ernährungsverhaltens und des Mahlzeitenrhythmus. Bis zum Beginn der Industrialisierung in Deutschland konnte man zwei Stunden und mehr tafeln, nun mussten die Zeiten der Mahlzeitenaufnahme aufs Strengste rationalisiert und gleichsam an das neue Maschinenwesen adaptiert werden (vgl. Teuteberg / Wiegelmann 1972, S. 72).
Das Historienbild Eisenwalzwerk von Adolph von Menzel (MATERIAL 5 A, S. 44) hat diese beschränkte Ernährungssituation der Arbeiter anschaulich populär in die Geschichtsbücher getragen.
Hans Baluschek als Vertreter einer sozialkritischen Malerei zeigt, wie die Frauen in die Reproduktionsarbeit eingebunden werden und das Essen für ihre Männer im mehrteiligen Henkelmann zur Fabrik schaffen (MATERIAL 5A, S. 44).
Essen im Vorübergehen ist schon auf Marktszenen des 16. Jahrhunderts zu beobachten: Kleine Imbissbuden boten dort den hungrigen Passanten alle möglichen Gebäcke oder gebrutzelte Leckereien an. Der Siegeszug dieser raschen Bedürfnisbefriedigung zur Stillung von Hungergefühlen ist somit heute nur die Fortführung einer bewährten Problemlösung mithilfe von kleinen, meist gut sättigenden Mahlzeiten (MATERIAL 5 B, S. 45): Currywurst, Döner, Würstel, Fleisch-Spieße, Pizzastücke, Pommes und Co. stehen also in einer kulturgeschichtlichen Tradition.
Doch das Problem der unentbehrlichen Ernährung unterwegs und fern vom eigenen Haushalt wandelte sich in der Moderne durch Massenbeschäftigung in Großbetrieben mit ihren je eigenen Pausenzeiten. Das Militär mit seinem Heer von Soldaten, oft weit entfernt von der heimatlichen Kaserne, übernahm bei der Verpflegungsorganisation eine Art Pilotfunktion. Eingefügt in die Zwänge von Entfernung und knapper Zeit, eroberte das rasch zu bereitende Mahl einer sogenannten „Systemgastronomie“ aus vorgefertigten Convenience- Zutaten und Aufgewärmtem die Massenernährung. So wurde die ehedem mobile Feldküche der Armee gewissermaßen durch die stationäre Betriebskantine, Mensa, Autobahnraststätte oder auch das Essen auf Rädern ersetzt und erweitert.
Die Liberalisierung gesellschaftlicher Umgangsformen hat das Benehmen bei Tisch gelockert. Umso mehr gelten nuancierte Verhaltensregeln in gesellschaftlichen Gruppen, die ihr Distinktionswissen auch mit Tischsitten zur Abgrenzung von all den lockeren Essstilen unterstreichen. So werden hochpreisige Kurse angeboten, in denen der angemessene Umgang mit Spezialbestecken für den Verzehr von Edelfischen bis hin zur Konversation gelehrt wird.
Anregungen
Hierzu bieten sich Vergleiche mit heute ganz unterschiedlichen Formen der Massenverköstigung in Betriebskantinen und Mensen an.
Andere Länder, andere Sitten
Vom Pfeffer bis zur Kartoffel, von der Pizza bis zu Sushi – die Reihe der über neue Handelswege, Expeditionen, Gastarbeiter und vor allem Urlaubsreisen nach Europa importierten und allmählich mit der heimischen Küche adaptierten Nahrungsmittel ist lang. Und immer gehen neue Sitten des Verzehrs mit der exotischen Speise einher. Trotz kultureller Amalgamierungen verhelfen solche Unterschiede etwa in der formalen Gestaltung der Esswerkzeuge dazu, Differenzerfahrungen hinsichtlich ästhetischer Esscodes anzubahnen. So gilt es etwa in Japan als unziemlich, sein Essen mit Stäbchen aufzuspießen und diese damit als strikt vom Tisch verbanntes Messer umzufunktionieren. Ebenso zeigt sich mit den Bento-Boxen in ihren z. T. edlen Ausführungen, dass das Speisen in Japan unterwegs keinesfalls als ein Sittenverfall, sondern bereits seit dem Hochmittelalter als traditionelle – auch vom Adel praktizierte – Verpflegungsform anerkannt wurde. Die aus Esswerkzeugen und Essbehältnissen resultierende Vorkonfektionierung der Gerichte führt denn auch u. a. zu Ausgabepraxen wie den elektronischen Sushi-Bändern, die frische und sofort verzehrfähige Speisen direkt zum Gast transportieren.
Anregungen
Zum weiten Themenfeld bieten sich Befragungen von Restaurantbesitzern ebenso wie Beobachtungen in Restaurants an. Welche Esssitten halten Einzug, wie werden sie gegenüber ihren Ursprungsländern transformiert und wie vermischen sie sich mit hiesigem Verhalten bei Tisch? Die Verpackungen wie die Werbeclips der Lieferdienste fordern eine Analyse heraus. Kataloge und Online-Präsentationen von Porzellan- und Besteckherstellern bieten einen breiten Fundus für die Recherche der Schülerinnen und Schüler; im Netz gibt es zahlreiche Stilberater
(z. B. www.stil.de). Ergänzt um die wachsenden Einflüsse einer einst exotischen Küche und deren Zubehör für den Tisch kann auf diese Weise eine umfangreiche Präsentation entstehen, die die rasante Pluralisierung der Essgewohnheiten und des Verhaltens beim Essen demonstriert und dem Abgleich mit den kulturgeschichtlichen Dokumenten eine Dynamik in vielen Differenzierungen ausweist. Einen eigenen Fundus bilden Essszenen in Spielfilmen. Auf der dem Filmfestival Berlinale wird seit einigen Jahren dem „Kulinarischen Kino“ sogar eine eigene Festival-Sektion gewidmet.
Street Food und Food Trucks
Mit den Food Trucks kommt das Bedürfnis nach Essen erneut auf die Räder und zu den Menschen in der Stadt mit wenig Zeit zum Essen und doch dem Anspruch, neben Currywurst und Döner hochwertige und variantenreiche Speisen anzubieten. Dabei steht der experimentelle Charakter, die Herausforderung frischer und wenig bekannter Speisen unter mobilen Bedingungen im Vordergrund. Auf den Festivals der Food Trucker geht es um spielerischen Wettbewerb, um kreative Küche. Dabei vermischen sich international inspirierte Esssitten zugunsten einer höheren Qualität.
Anregungen
Der Trend zum Edel-Essen-auf-Rädern kann in einer Dokumentation festgehalten werden. Schülerinnen und Schüler können angeregt werden, eigene Konzepte für mobile Imbisstände zu entwickeln – etwa für Schulfeste.
Literatur
-
•Oikos. Von der Feuerstelle zur Mikrowelle, Haushalt und Wohnen im Wandel. Ausstellungskatalog: Gießen 1992.
-
•Peter, Peter: Kulturgeschichte der deutschen Küche. München 2009.
-
•Schürmann, Thomas: Tisch- und Grußsitten im Zivilisationsprozess. Münster 1994.
-
•Schlosser, Eric: Fast Food Gesellschaft: Die dunkle Seite von McFood & Co. München 2002.
-
•Teuteberg, Hans-J. / Wiegelmann, Günther: Der Wandel der Nahrungsgewohnheiten unter dem Einfluss der Industrialisierung. Göttingen 1992.
-
•Zischka, Ulrike u. a.: Die anständige Lust. Von Esskultur und Tafelsitten. München 1993.